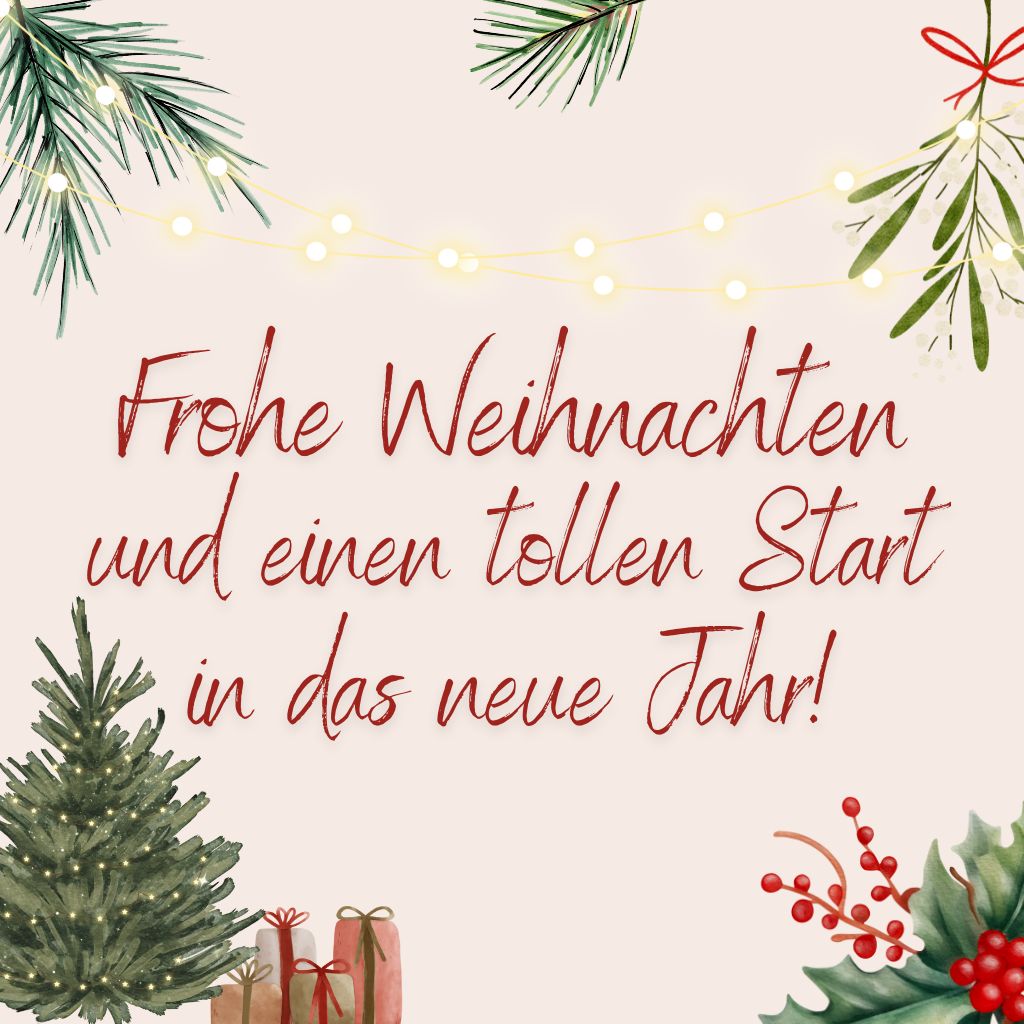Pädagogische Konzeption der Krippen- & Kindergarten-Einrichtungen
Über uns
Am Anfang stand eine Idee und die Bereitschaft, Verantwortung für unser Gemeinwesen zu übernehmen…
Mit großem Engagement und Teamgeist schuf der Tausendfüßler Kinder- und Familiengarten Kaltenkirchen e.V. ab 1992 kinder- und familienfreundliche Lebensräume zuerst in Kaltenkirchen, später auch in anderen Kommunen in Schleswig-Holstein und entwickelte sie stetig weiter.
Orte für Kinder wurden so zu Orten für Jung und Alt, an denen Bürger wieder mehr Gemeinsinn entwickeln, Verantwortung übernehmen und sich an der Planung ihres Umfeldes aktiv beteiligen, – ein echtes Lernfeld für gelebte Demokratie.
Mit der großartigen Entwicklung des Familienvereins wuchsen die Verantwortung und die Anzahl der Mitarbeitenden. Um die unverzichtbare Werteorientierung für die Zukunft als Maßstab des Wirkens zu sichern, wurde die Tausendfüßler Stiftung am 1. Oktober 2013 errichtet, die in Folge alle Betriebe und Aufgabenfelder des Familienvereins übernahm und damit als Garant für die Weiterentwicklung wirkt.
Mit der Tausendfüßler Stiftung stellen wir uns gemeinsam neuen Herausforderungen.
Die dynamische Weiterentwicklung unseres Unternehmens basiert auf
- der Zugewandtheit zu Menschen und ihren Bedürfnissen
- unserem Verantwortungsbewusstsein für
- unsere Gesellschaft
- unserer Lernfreude
- unserem Engagement
- unserem Teamgeist
- und unserem Mut zur Veränderung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Unternehmenskultur ist neben der Angebotsvielfalt und der Qualität der geleisteten Arbeit unser Markenzeichen.
Der sorgsame Umgang miteinander, der sich in einer wertschätzenden Kommunikation nach innen und außen zeigt, trägt zur Qualität unserer Arbeit bei.
Wir haben Freude an unserer Arbeit und engagieren uns leidenschaftlich für eine Weiterentwicklung in unseren Aufgabenfeldern und somit des gesamten Unternehmens.
Die Bereitschaft, mit anderen Augen zu sehen und somit neu zu denken, ermutigt alle Mitarbeitenden, aktiv Ideen zu entwickeln.
Verbunden mit Fachwissen, großer Leistungsbereitschaft und Flexibilität werden die Aufgabenfelder qualitativ und auch quantitativ gemeinsam weiterentwickelt.
Dabei kommen der Nachhaltigkeit und der Zukunftsfähigkeit unserer Leistungen ein großer Stellenwert zu.
Unsere Unternehmenskultur basiert auf Werten, die alle Mitarbeitenden gemeinsam definiert haben:
- Lebensbejahend
- Lösungsorientiert
- Soziale Verantwortung
- Innovation
- Teamorientierung
- Wertschätzung
- Empathie
- Offenheit
- Engagement
- Toleranz
- Stärkenorientierung
- Leistungsbereitschaft
- Verlässlichkeit
- Nachhaltigkeit
Unser Erfolg basiert auf unserer Haltung, unserer Professionalität, auf der Qualität unserer Arbeit und – unserer Unabhängigkeit!
Tausendfüßler Kindertageseinrichtungen
Kindertagesstätten für Krippen- und Kindergartenkinder
Kita Tausendfüßler Krückauring – Tausendfüßler Krippenhaus
Krückauring 114-116, 24568 Kaltenkirchen
Öffnungszeiten: 07:00-17:00 Uhr
Kontakt: kita.krueckauring@tf-stiftung.de / 04191-76536-200
Kita Tausendfüßler Hamburger Straße
Hamburger Str. 70, 24568 Kaltenkirchen
Öffnungszeiten: 07:00-16:00 Uhr
Kontakt: kita.hamburger-strasse@tf-stiftung.de / 04191-5070420
Kita Tausendfüßler Alter Landweg
Hamburger Str. 68a, 24568 Kaltenkirchen
Öffnungszeiten: 07:00-16:00 Uhr
Kontakt: kita.alter-landweg@tf-stiftung.de / 04191-5070420
Alvesloher Kita Tausendfüßler
Lindenstr. 2, 25486 Alveslohe
Öffnungszeiten: 07:00-17:00 Uhr
Kontakt: kita.alveslohe@tf-stiftung.de / 04193-97759
Campus Kita Tausendfüßler
Parkallee 42, 23845 Borstel
Öffnungszeiten: 07:00-17:00 Uhr
Kontakt: kita.borstel@tf-stiftung.de / 04537-7079903
Horteinrichtungen für Schulkinder
Tausendfüßler Grundschulbetreuung Flottkamp an der Grundschule Flottkamp
Am Hohenmoor 101, 24568 Kaltenkirchen
Öffnungszeiten: 07:00-17:00 Uhr
Kontakt: hort.flottkamp@tf-stiftung.de / 04191-60547
Tausendfüßler Grundschulbetreuung Lakweg an der Grundschule Lakweg
Lakweg 2-4, 24568 Kaltenkirchen
Öffnungszeiten: 07:00-17:00 Uhr
Kontakt: hort.lakweg@tf-stiftung.de / 04191-959947
Tausendfüßler Grundschulbetreuung Hamburger Straße an der Grundschule Alter Landweg
Hamburger Str. 70-72, 24568 Kaltenkirchen
Öffnungszeiten: 07:00-17:00 Uhr
Kontakt: hort.hamburger-strasse@tf-stiftung.de / 04191-956713
Herzlich Willkommen
- Sie benötigen einen Betreuungsplatz für Ihr Kind, der sich gut mit Ihrer familiären und beruflichen Situation vereinbaren lässt?
- Sie möchten, dass Ihr Kind seine Fähigkeiten in einer anregungsreichen Umwelt entdeckt, erweitert und neugierig seine Umgebung erlebt?
- Sie wünschen Ihrem Kind viel Spaß und Freundschaft in einer förderlichen Gemeinschaft?
- Sie wollen Gewissheit haben, dass es Ihrem Kind gut geht und es in seiner Entwicklung unterstützt und gefördert wird?
Wir bieten Ihnen und Ihrem Kind dazu jede Menge Möglichkeiten. Unsere Einrichtungen sind Orte für Kinder und Orte für Familien.
Wir laden Sie herzlich ein: Entdecken Sie auf den folgenden Seiten viele spannende Elemente aus dem Leben in unseren Kindertageseinrichtungen!
Unsere pädagogische Grundorientierung
Grundlagen
Freundlichkeit
Wir sind freundlich und respektvoll im Umgang mit Kindern, Eltern, Besuchern und Kollegen*innen. Wir sind allen gegenüber grundsätzlich wertschätzend. Unser Verhalten ist offen, einladend und zugewandt. Wir leben bewusst mit unseren Wertevorstellungen.
Beteiligung
Alle Beteiligten werden partnerschaftlich einbezogen. Ihre Mitwirkung ist sehr erwünscht und wird ermutigt. Kinder, Eltern, Fachkräfte, aber auch Interessierte und Engagierte aus dem Gemeinwesen sind herzlich eingeladen, bei uns mitzuwirken.
Integration
Unsere Einrichtungen für alle da. Wir bieten integrative Angebote, die sich an alle Kinder und Familien in einer Region richten, unabhängig von ihrer kulturellen Verschiedenheit und sozialen Herkunft.
Familienorientierung
Kinder und ihre Familien werden grundsätzlich im Kontext ihrer Lebensgeschichte und in ihren Lebens- und Beziehungswelten gesehen und verstanden, die aktiv zu unterstützen ein wesentliches Anliegen unserer Einrichtungen ist. Wir sind für unsere Familien da!
Bedarfsorientierung
Unser Leistungsangebot orientiert sich an der Lebenssituation von Familien. Es greift die Wünsche und Interessen der Eltern und Kinder pragmatisch und konkret auf. Wir denken bei allem was wir tun besonders über die Bedürfnisse von Kindern nach und messen daran den Erfolg unserer Arbeit.
Lernfreude
Die Neugierde der Kinder ist unser Vorbild. Engagiert gehen wir in die vielen täglichen Lernprozesse. Fehler verstehen wir dabei als Lernchancen. Gemeinsam neue Wege zu finden, motiviert uns. Gemeinsam neue Wege zu gehen, gibt uns Kraft für unsere pädagogische Arbeit und Vertrauen in unsere Zusammenarbeit.
Wir wissen, unser pädagogisches Konzept ist anspruchsvoll. Die Bedingungen im Kita-Alltag fordern Kraft und wirken oftmals erschwerend. Unser Anspruch an die Qualität unserer Arbeit bleibt aber bestehen.
Wir entwickeln unsere pädagogische Konzeption laufend weiter und orientieren uns dabei an den Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein.
Unsere Pädagog:innen
Unsere Teams sind so bunt wie unsere Familien. Sie setzen sich zusammen aus erfahrenen Kollegen, Berufsanfängern, Männern, Frauen, jungen und älteren Kollegen mit verschiedenen Qualifikationen.
Als hoch motivierte, gut ausgebildete Fachkräfte bilden sie starke Teams, die die Verschiedenheit der persönlichen Ressourcen jedes Einzelnen schätzen und kreativ nutzen. Jeder bringt sich selbst mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen ein. Alle sind eng verbunden durch ihren hohen professionellen Anspruch an ihre Aufgabe, ihre Freude an der beruflichen Arbeit und ihr persönliches Engagement für unsere Einrichtungen.
Die Verantwortung für die anspruchsvolle Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen wird von allen Mitarbeiter*innen und dem Träger gemeinsam getragen. Die stetig neuen Herausforderungen gehen alle zusammen motiviert an, sei es bei der Entwicklung und Gestaltung der Ganztagsbetreuung oder der Weiterentwicklung einer Kita zum Familienzentrum.
Offenheit und Loyalität helfen, Erfolge aber auch Fehler zu erkennen und zu verarbeiten. Das schafft Vertrauen zueinander und lässt ein besonderes „Lernklima“ entstehen.
Täglicher Informationsaustausch, Koordinationsgespräche, gemeinsame Planungen, Reflexionen und Feedback sind wichtige Bestandteile der kollegialen Zusammenarbeit auch zwischen unseren Einrichtungen. Wöchentliche Teamgespräche bieten eine feste Struktur, die Raum lässt sowohl für Organisation als auch Weiterentwicklung.
Im Rahmen des Tausendfüßler Qualitätsmanagements reflektieren und überprüfen die Mitarbeiter*innnen im Team fortlaufend ihre pädagogische Arbeit auf der Grundlage des „Nationalen Kriterienkatalog Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“.
Ergänzend führt eine große Bandbreite an Fortbildungen zur Weiterentwicklung der Qualität der täglichen Arbeit und trägt dazu bei, mit Freude die alltägliche pädagogische Arbeit gemeinsam mit den Kindern zu gestalten.
Die Tausendfüßler Stiftung bietet darüber hinaus eine enge Vernetzung mit allen anderen Tausendfüßler Fachbereichen von Frühe Hilfen bis Schulsozialarbeit und trägt somit zusätzlich zum Ausbau der Professionalität ihrer Mitarbeiter*innen bei.
Unsere Einrichtungen als Ausbildungsstätte
Berufspraktikant:innen
Neben unserem hohen Verantwortungsbewusstsein für die anspruchsvolle Arbeit mit unseren Kindern und Familien versteht sich die Tausendfüßler Stiftung auch als Ausbildungsort für pädagogische Fachkräfte. Eine gute, fachliche und kontinuierliche Begleitung zukünftiger pädagogischer Fachkräfte ist uns wichtig und wird als verantwortungsvolle Aufgabe angesehen.
Verschiedene Ausbildungsformen werden von unseren Fachteams unterstützt und pass-genau begleitet. Unser hoher Qualitätsanspruch zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Arbeitsbereiche und bietet Auszubildenden angemessene Voraussetzungen, praktische Erfahrungen zu sammeln sowie schulische Lehrinhalte mit der Praxis zu verknüpfen.
Neben dem Einsatz im jeweiligen Arbeitsbereich dienen regelmäßige Reflexionsgespräche als Ausgangslage, um Entwicklungsaufgaben und Handlungsperspektiven gemeinsam zu besprechen. Unter Berücksichtigung der schulischen Aufgaben lernen die Auszubildenden, sich aktiv am pädagogischen Alltag zu beteiligen und das eigene pädagogische Handeln zu reflektieren. Die Kinder, die Zusammenarbeit im Team und die Eltern bilden dabei die Schwerpunkte.
Als Lern- und Erfahrungsort zukünftiger pädagogischer Fachkräfte streben wir eine fachliche und persönliche Weiterentwicklung aller Beteiligten an und unterstützen die Berufs- und Fachschulen bei der Ausbildung von pädagogischem Fachpersonal.
Freiwilliges Soziales Jahr
Junge Menschen, die ihre Schulzeit beenden, stehen vor der Herausforderung, eine Entscheidung über ihren beruflichen Werdegang zu treffen. Ohne konkrete Berufsvorstellungen möchten sich viele erst im Arbeitsalltag erproben, bevor sie eine Ausbildung oder ein Studium beginnen.
Die Tausendfüßler Stiftung arbeitet mit dem internationalen Jugendgemeinschaftsdienst (ijdg) zusammen und ermöglicht jungen Menschen im Alter von 18-26 Jahren durch ein freiwilliges Soziales Jahr Einblicke in soziale Tätigkeitsfelder. Unter Anleitung unterstützen die Freiwilligen unsere pädagogischen Fachkräfte im Arbeitsalltag und lernen Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.
Als fester Bestandteil des Teams ermöglichen wir unseren FSJ-Kräften, sich mit ihren persönlichen Fähigkeiten, Interessen und ihrem persönlichen Engagement im Arbeitsalltag einzubringen und auszuprobieren. Dabei werden im Laufe des Freiwilligendienstes ihre sozialen, kulturellen, interkulturellen und persönlichen Kompetenzen gestärkt und weiter-entwickelt.
Unser Bild vom Kind
„Kinder brauchen Aufgaben, an denen sie wachsen können, Vorbilder, an denen sie sich orientieren können, Gemeinschaften, in denen sie sich aufgehoben fühlen.“ – Gerald Hüther
Wir verstehen Kinder als Konstrukteure ihrer eigenen Persönlichkeit. Sie sind von Geburt an aktiv, kompetent, kreativ und entscheiden selbst, in welcher Phase sie welche Fähigkeiten erlernen möchten. Dieser sogenannte Selbstbildungsprozess geschieht nicht in einem luftleeren Raum.
Kinder wollen sich ihre Welt selbsthandelnd und in einem Prozess aneignen, indem möglichst viele Sinne angesprochen werden.
Um dieses zu ermöglichen, bieten wir in unseren Kitas den Kindern einen entsprechenden Rahmen mit vielfältigen Möglichkeiten. Dazu gehören andere Kinder, die ihre Lernthemen teilen und pädagogische Fachkräfte, die Kinder beteiligen, begleiten, zusammen mit ihnen Fragen stellen und Antworten finden sowie ihnen neue Themen zumuten.
Die Persönlichkeit der Kinder entwickelt sich in einem stetigen Prozess. Täglich nehmen sie wahr, was um sie herum geschieht. Sie handeln, forschen, experimentieren, spielen und bauen sich dabei ein Bild von der Welt. Mit Hilfe guter Vorbilder und der sozialen Gemeinschaft ordnen sie diese Welt und geben ihr Sinn und Bedeutung.
Aus Kindersicht – Ich wünsche mir*:
…, dass du mir zuhörst, ohne über mich zu urteilen!
…, dass du meinen Interessen und Fähigkeiten Wertschätzung entgegenbringst!
…, dass du mir vertraust, ohne etwas zu erwarten!
…, dass du deine Meinung sagst, ohne mir Ratschläge zu erteilen!
…, dass du mich siehst, ohne dich in mir zu sehen!
…, dass du mir Mut machst, ohne mich zu bedrängen!
…, dass du mich umarmst, ohne mir den Atem zu rauben!
…, dass du meine Lernwege und meine Lösungen und mein Tempo achtest!
…, dass du mir hilfst, ohne für mich zu entscheiden!
…, dass du für mich sorgst, ohne mich zu erdrücken!
…, dass ich sein darf, wie ich bin!
*Erfolgreich starten, Inklusion in Kindertageseinrichtungen, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein, Mai 2018, S. 32-33
Unser Bild vom Kind findet sich wieder in dem Leitsatz von Maria Montessori wieder: Hilf mir es selbst zu tun.
Kindertagesstättengesetz
Kindertageseinrichtungen unterliegen der Kindertagesstätten-Verordnung (KiTaVo SH) und dem Kindertagesstätten-Gesetz (KiTaG SH) des Landes Schleswig-Holstein.
„Die Kindertagesstätten haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Dabei ist die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen und das leibliche, seelische und geistige Wohl des Kindes zu fördern. Dies geschieht vor allem durch die Förderung der individuellen Selbst-, Sozial- und Lernkompetenz und orientiert sich an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes. Das Erziehungsrecht der Eltern bleibt unberührt.“ (KiTaG SH, § 4 Abs.1)
Der Bildungsauftrag
Mit dem in § 4 KiTaG formulierten eigenständigen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag sind die Ziele der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit verknüpft.
Berücksichtigung sollen dabei im Kita-Alltag folgende Bildungsbereiche finden:
- Körper, Gesundheit und Bewegung
- Sprache, Zeichen/ Schrift und Kommunikation
- Mathematik, Naturwissenschaft und Technik
- Kultur, Gesellschaft und Politik
- Ethik, Religion und Philosophie
- Musisch- ästhetische Bildung und Medien
Die Bildungsbereiche spiegeln sich täglich in vielfältigen Alltagssituationen in den Kindertageseinrichtungen wieder. Viele neue Lernerfahrungen und damit Bildungsprozesse werden hier initiiert. Die pädagogischen Fachkräfte gestalten gemeinsam mit den Kindern den Tag in der Kita anregungsreich und spannend und orientieren sich dabei an den Themen der Kinder.
Die zentrale Aufgabe der Pädagog:innen besteht darin, die Kinder in ihren Bildungsprozessen zu unterstützen und ihnen einen Rahmen zu bieten, der ihre Bildungsmöglichkeiten erweitert. Ebenso gehört dazu, sie in ihrer Eigenaktivität zu stärken, durch gezielte Impulse Neugierde zu wecken und Sinnzusammenhänge herzustellen. Die Kinder werden ermutigt, sich auf neue Erfahrungen einzulassen und darin bestärkt, sich für die Erreichung eines Ziels anzustrengen.
Siehe „Erfolgreich starten“ – Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein
Qualitätsentwicklung in der pädagogischen Arbeit
Eine Konzeption ist nur so gut wie ihre Umsetzung. Eine anspruchsvolle pädagogische Konzeption allein ist kein Garant für eine hohe Qualität.
Ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem ist nötig, damit es gelingt, die konzeptionellen Grundsätze zuverlässig in eine entsprechende Fachpraxis zu überführen.
Dieser Prämisse stellt sich die Tausendfüßler Stiftung auch in ihrer Funktion als Träger ihrer Kindertagesstätten. Die auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene geregelten Verpflichtungen und Anforderungen zur Qualitätsentwicklung und -Sicherung werden in allen Kindertagesstätten der Tausendfüßler Stiftung entsprechend umgesetzt.
Gesetzliche Vorgaben auf Bundes- und Landesebene
In Tageseinrichtungen für Kinder soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigen- verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Dies umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (§ 22 KJHG).
Folgende Qualitätsziele lassen sich besonders hervorheben, die sowohl im KJHG als auch in Landesausführungsgesetzen der Länder ausdrücklich genannt sind:
- Das Leistungsangebot der Kindertageseinrichtung soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.
- Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit soll gefördert werden unter Berücksichtigung der individuellen und sozialen Situation jedes einzelnen Kindes.
- Die gemeinsame Erziehung von Kindern mit oder ohne Beeinträchtigung soll gefördert werden.
- Die Betreuung in Kindertageseinrichtungen soll auch dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.
- Die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen sollen berücksichtigt und die Gleichberechtigung gefördert werden.
- Ganzheitliche Erziehung soll gewährleistet sein und soziale, individuelle, kulturelle und ökologische Aspekte Berücksichtigung finden.
- In Zusammenarbeit mit den Eltern ergänzen und unterstützen Kitas die kindliche und familiäre Lebenswelt.
Kindertageseinrichtungen haben für die Umsetzung dieser Qualitätsziele einen eigenständigen Auftrag in der Jugendhilfe, der von der Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder bestimmt wird.
Im Jahr 2004 hat die Jugend- und die Kultusministerkonferenz einen „Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen“ verabschiedet.
In diesem Rahmen wird die „Sicherung und Weiterentwicklung von Qualität“ als ein Ziel genannt, zu dessen Erreichung „Verfahren der Selbst- und der Fremdevaluation“ eingesetzt werden sollen.
Damit die Übersetzung der konzeptionellen Grundsätze in hochwertige pädagogische Praxis nachhaltig gelingt, fordert das Sozialgesetzbuch VIII (§§ 22a, 78c, 79, 79a) ein geeignetes Qualitätsmanagementsystem in Kitas.
Es hat die Aufgabe, pädagogische Qualität mess- und überprüfbar zu machen, um eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung zu sichern:
„…Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung für
- die Gewährung und Erbringung von Leistungen
- die Erfüllung anderer Aufgaben
- den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a
- die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen.“ (BMSFS 2013, S. 122)
Qualitätsmanagement in der Tausendfüßler Stiftung
Qualitätsentwicklung ist in sämtliche Strukturen und Abläufe in allen Fachbereichen integriert und wird als eine fortlaufende Aufgabe aller Führungskräfte sowie der an diesem Prozess beteiligten Fachkräfte verstanden.
In allen Betrieben der Tausendfüßler Stiftung ist Qualitätsentwicklung unmittelbarer Bestandteil der pädagogischen und organisatorischen Arbeit und Verantwortung. Qualitätsentwicklung hat dabei immer kurzfristige und unmittelbare, wie auch mittel- und langfristige Perspektiven und Ansätze.
Das Thema Qualitätsentwicklung ist auf allen hierarchischen Ebenen fest verankert.
Nach dem Verständnis der Tausendfüßler Stiftung dient Qualitätsentwicklung nicht dem Selbstzweck, sondern hat sich stets an den Interessen und Bedürfnissen der Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Familien) in den verschiedenen Aufgabenfeldern zu orientieren.
Auch in unseren Kindertagesstätten erfolgt die konkrete Umsetzung der systematischen und zielorientierten Qualitätsentwicklung der pädagogischen Arbeit unter Beteiligung aller Fachkräfte. Wir verstehen uns als lernende Organisation und haben einen nachhaltigen Verbesserungsprozess in Form einer kontinuierlichen Selbstevaluation installiert.
Wir orientieren uns hierbei an dem „Nationalen Kriterienkatalog Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“, der länder-, träger- und konzeptionsübergreifend beste pädagogische Fachpraxis beschreibt und als Standardwerk in der pädagogischen Arbeit allgemein anerkannt ist. Er wurde im Rahmen der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten »Nationalen Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder« (NQI) entwickelt.
Qualitätsmanagement macht Instrumente nötig, mit denen wir überprüfen können, wie gut die Umsetzung der pädagogischen Grundsätze in der Praxis unserer Einrichtungen gelingt. Hierzu bewerten alle Fachkräfte regelmäßig ihre tägliche pädagogische Arbeit mit Hilfe von Checklisten, die für zwanzig Qualitätsbereiche existieren. Die durch die Auswertung der Checklisten ermittelte Selbsteinschätzung bildet den Ausgangspunkt für intensive, fachliche Diskussionen darüber, wie die pädagogische Qualität verbessert werden kann. Im Anschluss daran werden in den Teams der Einrichtungen gemeinsame Qualitätsziele vereinbart und die notwendigen Schritte zu deren Umsetzung geplant.
Alle diesen Prozess begleitenden Maßnahmen, wie beispielsweise Dokumentation und Verbindlichkeit der Vereinbarungen, müssen den Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechen. Anhand der erarbeiteten Zielindikatoren erfolgt eine Überprüfung der Zielerreichung. Diese Ergebnisse werden Bestandteil unserer Schlüsselprozesse oder dienen der Entwicklung neuer, weiterführender Ziele.
Qualitätsprüfung mit internen Audits
Zukünftig führt die Tausendfüßler Stiftung jährlich eine trägerinterne Prüfung, ein sogenanntes Audit, in ihren Kinderbetreuungseinrichtungen durch.
Pädagogische Fachkräfte aus einer Kita werden dazu in einer anderen Kita einen ganzen Tag verbringen. Anhand einer Checkliste, die sich aus dem QM-Handbuch ableitet und am Tagesablauf der Einrichtung orientiert ist, überprüft das Audit-Team, ob die Leitziele der pädagogischen Arbeit durchgängig erlebbar sind.
Qualitätsprüfung aus Sicht der Eltern
Im Rahmen des Tausendfüßler Qualitätsmanagements legt der Träger viel Wert auf Rückmeldungen aus der Elternschaft und hat dazu u.a. ein umfangreiches und nutzerfreundliches Beschwerdeverfahren entwickelt.
Den Eltern werden vielfältige Möglichkeiten geboten, die als wichtige Instrumente dazu beitragen, die Qualität der pädagogischen Arbeit mit Unterstützung der Eltern zu verbessern. Turnusmäßig werden Elternbefragungen durchgeführt, die ein umfassenderes Bild ermöglichen. Um zur Professionalisierung und Vereinfachung der Befragung beizutragen, haben wir Online-Befragungen eingeführt, die es Eltern ermöglichen, mit nur wenigen Klicks ein Meinungsbild über die Betreuungseinrichtung ihres Kindes abzugeben. Die einzelnen Fragestellungen werden weitgehend konstant gehalten, um eine Entwicklung in der Elternmeinung ablesen zu können.
Die Ergebnisse der Befragung werden in den Einrichtungen veröffentlicht und gemeinsam mit dem Träger, Fachbereichsleitung, Leitungskräften und dem Elternbeirat erörtert.
Blick der Kinder
In unseren Kindertagesstätten ermöglichen wir gelebte, alltägliche Partizipation, indem wir den Kindern zu bestimmten Themen ein klares Mitspracherecht einräumen und ihnen die alters- und entwicklungsgemäße Übernahme von Verantwortung zutrauen. Sie erfahren die Möglichkeit zu Wort zu kommen, gehört zu werden, an Entscheidungen beteiligt zu werden und ihren Alltag mit zu gestalten. Ihre unmittelbaren Rückmeldungen sind unverzichtbar und tragen zur Qualitätsentwicklung in unseren Einrichtungen erheblich bei.
Präsenz des Trägers
Der Anspruch des Trägers, alle Prozesse in den Einrichtungen praxisnah zu begleiten, zeitnah zu unterstützen und darüber hinaus Präsenz und Erreichbarkeit zu ermöglichen, erweist sich als förderlich für den direkten Dialog über die geleistete Qualität in der Kindertageseinrichtung und den daraus folgenden Prozess der Qualitätsentwicklung.
§ Kinderschutz
§ 8a – Kindeswohlgefährdung
Mit der Novellierung des SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz, ist auch die Tausendfüßler Stiftung in ihren vielfältigen Arbeitsfeldern gesetzlich verpflichtet, den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung wahrzunehmen.
Siehe Anlage C „Gesetzliche Grundlagen“
Da der Soziale Dienst (SD) des Jugendamtes im Kreis Segeberg als überörtlicher Träger der Jugendhilfe sein Vorgehen zum Schutzauftrag an den Grundlagen nach LüttringHaus orientiert, übernimmt die Tausendfüßler Stiftung verbindlich diesen ressourcen-, lösungs- und sozialraumorientierten Konzeptansatz, um zu einer einheitlichen Sprachregelung und Vorgehensweise der Beteiligten beizutragen.
Definition Kindeswohlgefährdung
Die Tausendfüßler Stiftung orientiert sich an der folgenden Definition:
“Kindeswohlgefährdung“ ist ein das Wohl und die Rechte eines Kindes (nach Maßstab gesellschaftlich geltender Normen und begründeter professioneller Einschätzung) beeinträchtigendes Verhalten oder Handeln bzw. ein Unterlassen einer angemessenen Sorge durch Eltern oder andere Personen in Familien oder Institutionen, (wie z. B. Heimen, Kindertagesstätten, Schulen, Kliniken oder in bestimmten Therapien), das zu nicht zufälligen Verletzungen, zu körperlichen und seelischen Schädigungen und/oder Entwicklungs-beeinträchtigungen eines Kindes führen kann, was die Hilfe und eventuell das Eingreifen von Jugendhilfe-Einrichtungen und Familiengerichten in die Rechte der Inhaber der elterlichen Sorge im Interesse der Sicherung der Bedürfnisse und des Wohls eines Kindes notwendig machen kann.”
(Quelle: Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V.: Kindeswohlgefährdung. Erkennen und Helfen, 11. überarbeitete Auflage, Berlin 2009, S. 32)
Formen der Kindeswohlgefährdung können sein:
- körperliche und psychische Gewalt
- Häusliche Gewalt
- Sexueller Missbrauch
- Gesundheitliche Gefährdung
- Aufsichtspflichtverletzung
- Aufforderung zur Kriminalität
- Autonomiekonflikt
- seelische Verwahrlosung
Anzeichen für die verschiedenen Formen der Kindeswohlgefährdung können sein:
- Ernährungs- und Gesundheitsprobleme
- Unter- oder Übergewicht
- Unzureichende Hygiene oder Kleidung
- Entwicklungsverzögerungen
- Auffällig aktives, passives, aggressives oder distanzloses Verhalten
- Arbeitslosigkeit oder finanzielle Schwierigkeiten
- Wohlstandsverwahrlosung
- Schlechte Wohnverhältnisse
- Überlastung und/oder Überforderung der Erziehungspersonen
- Alkoholkonsum oder andere Suchterkrankungen
- Psychische Erkrankungen
- Trennung/Scheidung
- Unregelmäßiger Kindertagesstätten-/ Schulbesuch
Kinderschutzvorgaben für die pädagogischen Mitarbeiter der Tausendfüßler Stiftung
- Alle in den Einrichtungen tätigen Mitarbeiter*innen legen dem Träger bei Einstellung und im Weiteren alle 5 Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vor.
- Die Fachkräfte wissen um die verschiedenen Formen der Kindeswohlgefährdung und verfügen über Grundkenntnisse zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung.
- Schwellenwerte markieren den Ausgangspunkt einer erhöhten fachlichen Aufmerksamkeit und sind Auslöser für die nächsten Schritte: Beobachten, Dokumentieren, Informieren, Austausch.
- Die Fachkräfte klären in Form einer „Kollegialen Kurzberatung zur Risikoeinschätzung nach LüttringHaus“, in welchen Bereich der Gefährdungseinstufung die beschriebenen Auffälligkeiten einzuordnen sind und welches Vorgehen im konkreten Fall anzuwenden ist. Bei weiterer Klärung wird eine insoweit erfahrene Fachkraft (Fachbegriff) zur Gefährdungseinschätzung hinzugezogen.
- Soweit der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird, werden die Eltern sowie das Kind ebenfalls in die Gefährdungseinschätzung einbezogen. Die pädagogischen Fachkräfte wirken dabei auf die Inanspruchnahme von Hilfen hin, wenn sie diese für erforderlich halten.
- Wenn die Gefährdung durch die Hilfen nicht abgewendet werden kann, wird mit Unterstützung der Kinderschutzbeauftragten der Stiftung das Jugendamt informiert.
In unserer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien lassen wir uns von folgenden Grundsätzen leiten:
Kinder haben ein Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit sowie auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung.
Wir respektieren die körperlichen und emotionalen Grenzen von Kindern, Jugendlichen und Familien.
Wir arbeiten mit den uns anvertrauten Kindern, Jugendlichen und Familien ressourcenorientiert und nehmen Kinder, Jugendliche und Familien ernst.
Grundlage für eine positive Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Kindern, Jugendlichen und Familien ist die Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung.
Wir setzen voraus, dass Eltern selbstbestimmt handeln und ihre Rechte und Pflichten zur Erziehung ihrer Kinder verantwortungsbewusst wahrnehmen können.
Kinderschutz hat oberste Priorität für unser Handeln. In unserer Arbeit nehmen wir bereits frühzeitig Anzeichen für eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls wahr.
Wir kennen und nutzen Hilfesysteme der Familie, des sozialen Umfeldes, des internen und externen Netzwerkes.
Wir arbeiten transparent, vertrauenswürdig und unter Beachtung des Datenschutzes. Der besondere Vertrauensschutz in unserer Arbeit ist uns wichtig.
Gespräche mit und über Menschen, die sich in einer problematischen Situation befinden, finden unter besonderer Sorgfalt statt. Dabei sind wir sensibel und aufmerksam.
Unsere Fachkräfte sind in der Lage, gefährdende Situationen und Zustände wahrzunehmen, sie zu dokumentieren und angemessene Handlungsschritte einzuleiten.
Ein klarer und eindeutiger Verfahrensablauf bei bestehendem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung gibt allen pädagogischen Mitarbeitern Sicherheit im Umgang mit dieser äußerst sensiblen Thematik.
Beobachtungen, Gesprächsergebnisse und Vereinbarungen werden dabei grundsätzlich dokumentiert. Diese Dokumentationen bilden die Grundlage für ein verbindliches, nachvollziehbares und abgestimmtes Handeln.
Besteht der konkrete Verdacht einer akuten Kindeswohlgefährdung, so ist die Informationsweitergabe an das Jugendamt im Rahmen des §8a SGB VIII zwingend erforderlich, um den Schutz des Kindes sicherzustellen.
Siehe Anlage C „Gesetzliche Grundlagen Kinderschutz“
Unser Ziel ist es, frühzeitig Situationen zu erkennen, die die positive Entwicklung von Kindern beeinträchtigen, und gezielt individuelle Unterstützung für Kinder und Eltern anzubieten, damit Probleme erst gar nicht entstehen oder sich verfestigen.
Erziehung ist wahrlich kein Kinderspiel!
Je jünger Kinder sind, desto stärker sind sie abhängig davon, auf verantwortungsvolle Menschen zu treffen, die sich dafür einsetzen, dass ihre elementaren Grundbedürfnisse nach Schutz, Sicherheit, Liebe und Wertschätzung befriedigt werden, damit sie sich zu selbstbewussten und verantwortungsvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft entwickeln können.
Immer neue Herausforderungen bringen Eltern manchmal an den Rand ihrer Belastungsgrenze, familiäre oder wirtschaftliche Schicksalsschläge bringen das familiäre Gleichgewicht ins Wanken.
Wir sind für Sie da!
Beiderseitige Offenheit und das Benennen von Problemen helfen, eine gelingende Erziehungspartnerschaft zum Wohle der Kinder zu gestalten.
Da, wo wir nicht mit allen Aufgabenfeldern vor Ort sind, kooperieren wir mit den passenden Partnern in der Kommune. Starke interne und regionale Netzwerke und eine gute Zusammenarbeit mit anderen Institutionen vor Ort stellen sicher, dass wir Familien kontinuierlich begleiten können. Die Kooperation mit externen Partnern wie z. B. die Grundschulen, Erziehungsberatung, dem Sozialen Dienst und weiteren Trägern der Jugendhilfe garantiert eine schnelle Unterstützung im Krisenfall.
Mit der konsequenten Weiterentwicklung von innovativen, bedarfsgerechten und attraktiven Angeboten, die sich an den Bedürfnissen unserer Familien orientieren und gemeinsam mit ihnen entwickelt werden, tragen wir zur Stärkung und Entlastung der Familien im Alltag bei.
Unseren Kindertagesstätten sind „Orte für Familien“, da wir
- uns der ständigen Veränderungen in unserer Gesellschaft bewusst sind
- um die komplexe Lebenswirklichkeit von Familien wissen
- Eltern bzw. Familien als unverzichtbare Partner sehr wertschätzen
- unsere Angebote konsequent an den Bedürfnissen der Familien orientieren
- die Eltern bei den vielfältigen Möglichkeiten der aktiven Beteiligung unterstützen
- die Bindungs- und Beziehungsqualität für Eltern und Kinder nachhaltig sicherstellen
- über eine hohe Professionalität verfügen verbunden mit großem Engagement
- die Zusammenarbeit mit Familien als unverzichtbar und motivierend erleben
Familie
Familien willkommen!
Familien sind in allen Tausendfüßler Einrichtungen stets herzlich willkommen.
Unsere Gesellschaft ist in ständiger Bewegung. Gesellschaftliche Veränderungen haben Auswirkungen auf Familien, Kinder, Beruf, Partnerschaft…
Familien erleben dadurch vielfältige Herausforderungen. Ein gelungenes Familienleben und ein familienfreundlicher Alltag sind keine Selbstverständlichkeit. Dabei sind Familien unterschiedlich und bunt: alleinerziehende Mütter oder Väter, Patchwork-Familien, Regenbogen-Familien, Flüchtlingsfamilien, arbeitssuchend, psychisch belastet, mit einem oder mehreren Kindern, mit Migrationserfahrung oder die klassische Familie mit Vater, Mutter, Kind.
Sie alle finden Platz und Begleitung bei uns.
Mit Engagement und Knowhow entwickeln wir bedarfsgerechte familienfreundliche Infrastrukturen, die sich an den Bedürfnissen der Familien orientieren, und tragen so zur Stärkung und Entlastung der Familien im Alltag bei.
Die enge Verzahnung unserer vielfältigen Aufgabenfelder – von den Frühen Hilfen über Krippen-, Kindergarten- und Hortbetreuung, Kindertagespflege, Familienzentrum, Schul-sozialarbeit, Jugendhaus, Koordination der Offenen Ganztagsschulen bis zu den vielfältigen Angeboten in unserem Mehrgenerationenhaus – stellt sicher, dass Familien bei uns durch gut begleitete Übergänge nachhaltige und aufeinander aufbauende Unterstützung finden.
Hilfreich sind dabei kurze Wege und ein vertrauensvolles Miteinander. Da, wo wir nicht mit allen Aufgabenfeldern vor Ort sind, kooperieren wir mit den passenden Partnern in der Kommune. Wir kümmern uns – flexibel und unbürokratisch.
Die Bandbreite der Tausendfüßler Aufgabenfelder belegt die Ausrichtung auf Kinder und Familie. Alle Betreuungsangebote werden konsequent an den veränderten Bedarfen der Familien ausgerichtet und unterstützen sie bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. Dabei weiten wir in unseren Kitas und Horteinrichtungen nicht einfach unsere Angebote für Eltern und Familien aus, wir entwickeln sie gemeinsam mit unseren Familien. Nach wie vor steht dabei das Kind im Mittelpunkt unserer Arbeit. Doch nehmen wir mit dem Kind stets auch die dazugehörige Familie bewusst in unsere Betreuungseinrichtung auf.
Eine gute und intensive Kommunikation und der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Einrichtung und Familie ist die Voraussetzung für eine enge Verzahnung von institutioneller Erziehung und Familienerziehung.
Kita-Fachkräfte und Familien müssen sich für diesen wechselseitigen Prozess öffnen und sich mit einer qualifizierten Form der Familienzusammenarbeit auseinandersetzen. Es braucht Zeit, um Vertrauen zu entwickeln, und Gelegenheiten, sich kennenzulernen und miteinander in Kontakt zu treten.
Zusammenarbeit mit Eltern
Die Tausendfüßler Stiftung bietet einen unterstützenden Rahmen für eine aktive Elternschaft. Dabei wirken die von der Elternschaft gewählten Elternvertreter, die sich in regelmäßigen Abständen treffen, als eine unterstützende Schnittstelle zwischen dem Fachteam der Kita und der Elternschaft. Gemeinsam werden Ideen zur Unterstützung der Kita-Arbeit entwickelt und in die Tat umgesetzt, sei es bei der Mitgestaltung eines Festes, bei der Reparatur von Spielmaterial oder dem tatkräftigen Einsatz bei der Gartengestaltung. Dazu gehört eine offene Gesprächskultur im Miteinander.
Ein Orientierungspunkt in der Zusammenarbeit sind die verbindlich festgelegten Eltern-Dienststunden, die von den Familien jeweils im Kitajahr zu leisten sind. Verbindliches Engagement auf Seiten der Eltern und der Mitarbeiter*innen sowie des Trägers auf der anderen Seite zeichnen die gegenseitig unterstützende Kultur im Miteinander auf. Getragen sind alle von der Überzeugung, dass vieles gemeinsam bewegt werden kann und gemeinsam (fast) alles zu schaffen ist.
Gerne treten wir in einen dauerhaften Dialog mit unseren Eltern, um ihnen vielseitige Einblicke in die pädagogische Arbeit zu bieten und mit ihnen die Entwicklung ihres Kindes zu begleiten. Der intensive Austausch mit den Eltern wird ermöglicht durch:
- Ausführliche Anmeldegespräche – Wir nehmen uns Zeit! Hier erhalten interessierte Eltern die Gelegenheit, die Tausendfüßler Stiftung und das pädagogische Konzept kennen zu lernen, ihre Fragen zu stellen und die Räumlichkeiten der Einrichtung anzuschauen, um eine bewusste Entscheidung für den Kitabesuch ihres Kindes zu treffen.
- Erstgespräche mit der Gruppenfachkraft vor Beginn des eigentlichen Kita-Starts, um eine gute Eingewöhnung zu planen und sich über Besonderheiten auszutauschen
- Individuelle und bedarfsgerechte Elterngespräche sowie Beratungsgespräche über die Entwicklung des Kindes
- Elternabende: Mindestens zweimal jährlich stellt das Team der Kita die aktuelle pädagogische Arbeit vor und gibt einen Ausblick auf weitere Planungen. Der Rahmen bietet immer einen Austausch der Eltern untereinander.
- Eltern-Hospitationen: Wir laden unsere Eltern gerne ein, ihr Kind im Tagesablauf in
der Kita einmal zu begleiten. - Familien-Café: Um den Kontakt untereinander zu fördern, sind Familien gerne gesehene Gäste im Familien-Café. Hier bietet sich ihnen die Gelegenheit, entspannt Einblicke in die Kita-Arbeit zu gewinnen.
- Feste: Unsere Feste sind immer ein Anlass, Familien besonders willkommen zu heißen.
- Gartentage: Zweimal im Jahr greifen wir gemeinsam zu Spaten, Harken und Schubkarren, um das Naturaußengelände auf Vordermann zu bringen. Unsere Gartentage bieten eine gute Gelegenheit, um Elternstunden zu leisten und dabei andere Familien kennenzulernen.
- Feedback: Im Rahmen des Tausendfüßler Qualitätsmanagements legt die Tausendfüßler Stiftung viel Wert auf Rückmeldungen aus der Elternschaft. Dazu werden vielfältige Möglichkeiten geboten, u. a. Elternbefragungen, die als wichtige Instrumente dazu beitragen, die Qualität der pädagogischen Arbeit mit Unterstützung der Eltern zu verbessern.
Darüber hinaus erweist sich die Präsenz des Trägers und die Erreichbarkeit vor Ort als vorteilhaft für den direkten Dialog zwischen Eltern und Tausendfüßler Stiftung.
Siehe Anlage A „Beteiligungsverfahren“
Das Kindertagesstätten Gesetz (KiTaG)
…regelt die inhaltlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen von Kindertageseinrichtungen sowie die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Einrichtungen.
„Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Kindertageseinrichtung besuchen, sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Kindertageseinrichtung zu beteiligen. Die Erziehungsberechtigten bilden die Elternversammlung.“ (§ 17 KiTaG)
Eltern haben in der Elternversammlung die Möglichkeit und die Chance, sich zu unterschiedlichsten Themen auszutauschen, zu beraten und gegenseitig zu unterstützen. Mit der Wahl einer Elternvertretung sollen Sie darüber hinaus an Entscheidungen der Kindertageseinrichtung mitwirken und so maßgeblich, in kooperativer Zusammenarbeit mit der Kindertageseinrichtung, die Zukunft ihrer Kinder mitgestalten.
Die Kita Elternvertretung nach § 17 Abs. 4 KiTaG
Die Eltern wählen jährlich aus ihren Reihen Elternvertreter*innen, die regelmäßig mit den Teamleitungskräften und dem Träger zusammenkommen. Bei diesen Zusammenkünften wird informiert, diskutiert, kritisch hinterfragt, angeregt, geplant und – natürlich auch viel gelacht…
Der Kita-Beirat nach § 18 KiTaG
Entsprechend der Vorgaben des Kita-Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein nehmen gewählte Elternvertreter*innen am Kita-Beirat teil, der sich gemeinsam mit Träger und kommunalen Vertretern mit den Belangen der Kita auseinandersetzt.
Die Kita Gemeinschaft
In unseren Kitas engagieren sich alle Beteiligte, Träger, Mitarbeiterteams, Eltern und auch Kinder, füreinander. Das zeichnet unsere Einrichtungen aus. Zu diesem Engagement zählen auch die Elternstunden, die im Kitajahr zu leisten sind. Sie tragen sichtbar dazu bei, dass die Kita ein Paradies für unsere Kinder ist, und stärkt darüber hinaus die Solidargemeinschaft in der Kita.
Das lebendige Miteinander in einer Tausendfüßler Kita ist erkennbar, wenn
- Aktivitäten in der Kita organisiert werden
- Arbeitszeit, Material und Knowhow gespendet werden
- Erziehungsfragen gemeinsam diskutiert werden
- Elternvertreter:innen und Kita konstruktiv miteinander zusammenarbeiten
Liebe Eltern, gemeinsam begleiten wir Ihr Kind dabei, seinen eigenen Weg zu finden und dabei seine Potenziale in einem spannenden Prozess optimal zu entfalten. Wir freuen uns über Ihre aktive und unterstützende Teilnahme am Leben Ihres Kindes in unserer Kita!
Der Kita-Start
Bindung und Beziehung
Damit ein Kind sich in unserem Haus wohl und geborgen fühlt und sich den spannenden Themen des Kita-Alltags zuwenden kann, braucht es Menschen, die es verlässlich begleiten. Der feinfühlige Aufbau einer festen und verlässlichen Beziehung zwischen Kind und pädagogischen Fachkräften und das Schaffen einer von Vertrauen geprägten Zusammenarbeit mit den Familien ist das Fundament unserer Arbeit.
Hierbei spielt die Gestaltung des Übergangs aus der Familie in die Kita eine entscheidende Rolle. Im engen Dialog mit den Eltern kommunizieren wir unsere Vorgehensweise und beziehen sie aktiv und individuell mit ein. Das zugewandte Einbeziehen schafft Vertrauen und vermittelt den Eltern das Gefühl, dass ihr Kind in ihrer Abwesenheit gut betreut und versorgt ist.
Was bedeutet Bindung in der Kita?
Vom ersten Lebenstag an erlebt das Kind Bindung. So erfährt es zunächst über die Beziehung zur Mutter/zum Vater zwischenmenschliche Beziehungen, die dazu dienen, seine Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, körperliche Zuwendung zu befriedigen.
Die ungeteilte Aufmerksamkeit von Mutter/Vater und die Verlässlichkeit ihres Handelns ermöglichen es dem Kind, sich selbst als Person wahrzunehmen und schaffen so die Grundlage für seine optimale Entwicklung. Zugleich erfährt es in diesen Beziehungen, wie es durch sein eigenes Verhalten Einfluss auf seine Umgebung nehmen und Veränderungen herbeiführen kann. Ohne die Unterstützung von Mutter/Vater ist dieser lebenswichtige Lernprozess nicht möglich.
Wenn das Kind älter wird, vergrößert sich der Kreis der Personen, mit denen es in Kontakt tritt. Eine sichere Bindung im Elternhaus erleichtert es ihm, neue bindungsähnliche Beziehungen einzugehen.
Beim Besuch einer Kindertagesstätte spielt das Bindungsverhalten eine große Rolle. Damit ein Kind sich in einer Kita wohl und geborgen fühlt und sich den spannenden Themen des Kita-Alltags zuwenden kann, braucht es Menschen, die es verlässlich begleiten.
Der gelingende, feinfühlige Aufbau einer festen und verlässlichen Beziehung zwischen Kind und Pädagogen ist die entscheidende Grundlage für unsere Arbeit.
Ohne Eltern geht es dabei nicht. Voraussetzung ist eine gute Kommunikation auf Augenhöhe, die den Eltern ermöglicht, den Prozess des Ankommens ihres Kindes in der Kita zu verstehen und sie für eine aktive Mitgestaltung zu gewinnen. Als Experten ihres Kindes sind sie unverzichtbare Gesprächspartner.
Das Vertrauen der Eltern trägt entscheidend dazu bei, dass sich eine sichere emotionale Bindung zwischen Kind und Kitafachkraft entwickeln kann. Diese behutsame Bindung ermöglicht es dem Kind, sich forschend und entdeckend seiner Umwelt zuzuwenden.
Informationen zur Eingewöhnung
Liebe Eltern!
Sicherlich fällt es Ihnen nicht leicht, sich von Ihrem Kind zu trennen.
In dieser Phase der Veränderung im Leben Ihres Kindes möchten wir Ihnen und Ihrem Kind helfen, sich an uns zu gewöhnen und Vertrauen zu gewinnen. Für Ihr Kind sind Sie als Mutter/ Vater die wichtigste Bezugsperson.
Nur Sie können Ihrem Kind in der ersten Zeit durch Ihre Anwesenheit in der neuen Umgebung die Sicherheit geben, die es für seine Eingewöhnung in die Kita braucht. Jedes Kind reagiert unterschiedlich auf ungewohnte Situationen. Das eine Kind braucht kürzere, das andere Kind längere Zeit, um sich in den neuen Räumen und unter neuen Kindern und Erwachsenen wohl zu fühlen. Deshalb sollten Sie sich darauf einstellen, dass es von Ihrem Kind abhängt, wie lange Ihr Kind Ihre Begleitung in der Eingewöhnungszeit benötigt.
Es ist wichtig, dass in dieser Zeit immer dieselbe Person das Kind in die Kita begleitet. Bitte, kommen Sie so regelmäßig wie möglich mit. Lassen Sie Ihr Kind etwas von zu Hause mitnehmen, das ihm sehr vertraut ist.
Damit es für Ihr Kind einen sanften Übergang in die Kita gibt, ist es notwendig, dass Sie Ihr Kind in den ersten 3 Tagen nicht allein in der Gruppe lassen. Wenn sich Ihr Kind bei der ersten Trennung (meistens am 4. Tag) von uns nicht hat trösten lassen, stellen Sie sich bitte darauf ein, dass es noch eine Weile dauern wird, bis Sie Ihr Kind alleine in der Gruppe lassen können.
Hier einmal ein Beispiel für einen Eingewöhnungsprozess
1.Tag
Wenn Sie mit Ihrem Kind zum ersten Mal in die Kita kommen, stürmen sehr viele neue Eindrücke auf Ihr Kind ein. Es ist deshalb völlig ausreichend, wenn sie mit Ihrem Kind eine halbe bis eine Stunde am Gruppengeschehen teilnehmen.
Sprechen Sie mit den pädagogischen Fachkräften den günstigsten Zeitpunkt für Ihren Besuch ab. Beobachten Sie Ihr Kind und warten Sie, bis es von sich aus Interesse an der neuen Umgebung zeigt. Ihr Kind hat die Möglichkeit, Sie als „sicheren Hafen“ zu benutzen, von dem aus es neue Bindungen aufbauen kann.
2. Tag
Möglichst zum gleichen Zeitpunkt wie am Vortag kommen Sie bitte mit Ihrem Kind wieder zu Besuch in die Gruppe. Auch diesmal reicht die Dauer von ungefähr einer Stunde, damit Ihr Kind mit Ihnen gemeinsam neue Eindrücke sammeln kann. Bitte bleiben Sie Beobachter und werden Sie nicht zum Spielpartner in der Gruppe. Unterstützen Sie die Kontaktaufnahme Ihres Kindes mit den neuen Bezugspersonen.
3.Tag
Auch der 3. Tag dient dazu, dass Ihr Kind sich ganz allmählich an die neue Umgebung gewöhnt. Sie geben ihm durch Ihre Anwesenheit die Sicherheit, die es für seine Erkundungen braucht. Wenn es sich ergibt, sollten Sie Ihr Kind bei Bedarf ruhig in der Kita wickeln, so gewöhnt sich Ihr Kind an den neuen Wickelplatz.
In der Regel wird Ihnen die pädagogische Fachkraft gerne zuschauen, um von Ihnen Hinweise auf eventuelle Besonderheiten zu erhalten.
Sie sollten ungefähr eine Stunde für Ihren Besuch einplanen.
4. Tag
Um herauszufinden, wie lange die Eingewöhnungszeit wohl dauern wird, machen wir am 4. Tag einen ersten kurzen Trennungsversuch. Bitte „schleichen“ Sie sich nicht hinaus, sondern verabschieden Sie sich von Ihrem Kind. Dann verlassen Sie den Raum, bleiben aber bitte in der Kita.
Beruhigt sich Ihr Kind nach kurzer Zeit nicht, werden Sie von uns sofort zurückgebeten. Ansonsten treffen wir mit Ihnen eine Absprache, wann Sie wieder in die Gruppe zurückkommen.
5. Tag
Nur wenn Ihr Kind sich beim Trennungsversuch am 4. Tag von uns hat trösten lassen, gehen wir davon aus, dass die Trennungszeit am 5. Tag erweitert werden kann. Auch in diesem Fall bleibt Ihre Anwesenheit in der Kita erforderlich, damit wir Sie bei Bedarf zu Ihrem Kind holen können, z.B. zum Mittagessen.
Wenn wir Ihr Kind beim Trennungsversuch am 4. Tag nicht trösten konnten, sollten Sie mit Ihrem Kind weiterhin am Gruppengeschehen teilnehmen, es in der Kita wickeln und füttern bzw. es in Ihrem Beisein am Mittagessen teilnehmen lassen. Danach gehen Sie gemeinsam nach Hause. Lassen Sie sich nicht entmutigen! Ihr Kind braucht noch etwas Zeit.
6. Tag
Sollte der 6. Tag ein Montag sein, unternehmen Sie bitte an diesem Tag keinen Trennungsversuch. Ihr Kind muss sich nach dem Wochenende erst wieder eingewöhnen. Auch wenn Sie an diesem Tag wieder gemeinsam mit Ihrem Kind nach Hause gehen, können Sie sicher sein, dass Ihr Kind Fortschritte bei der Eingewöhnung macht.
Schafft Ihr Kind es, heute schon alleine in der Kita zu bleiben, bitten wir Sie, für uns telefonisch erreichbar zu sein. Es ist durchaus möglich, dass Ihr Kind so intensiv nach Ihnen verlangt, dass es einfach wichtig ist, schnell bei Ihrem Kind zu sein.
7. Tag
Wenn zwischen Ihrem heutigen und dem letzten Besuch kein Wochenende oder ein sonstiger längerer Zeitabstand lag, können Sie einen weiteren Trennungsversuch unternehmen. Bitte bleiben Sie zunächst in der Einrichtung. Vorausgesetzt Ihr Kind lässt sich von uns trösten, sagen wir Ihnen Bescheid und Sie können die Kita in der Regel für 1 – 2 Stunden verlassen.
Ist dies nicht der Fall, holen wir Sie wieder herein und Sie gehen – am besten nach dem Mittagessen – mit Ihrem Kind nach Hause.
Auch wenn Ihr Kind in der 2. Woche ohne größere Probleme alleine in der Kita bleibt, sollten Sie es vorerst nach einem halben Tag z. B. nach dem Mittagessen abholen. Erfahrungsgemäß können Kinder eine schrittweise Eingewöhnung am besten verkraften, d. h. eine allmähliche Steigerung der Anwesenheitszeit.
Die Ruhephase Ihres Kindes wird in Absprache mit Ihnen individuell gestaltet. Neben dem Gruppenraum trägt vor allem der Nebenraum mit seiner kuscheligen Atmosphäre zur Entspannung bei. Die persönliche Decke sowie ein Schmusetier gehören zum gemütlichen Schlafplatz gerne mit dazu. Eine vertraute Pädagogin begleitet die Kinder während ihrer Schlafphase.
Wie wichtig eine behutsame Eingewöhnung in die Kita ist, haben langjährige wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurde das in Fachkreisen anerkannte „Berliner Eingewöhnungsmodell“ entwickelt, an dem wir uns mit unserem Eingewöhnungskonzept orientieren.
Gemeinsam mit Ihnen als Eltern schaffen wir somit eine entscheidende Voraussetzung für eine positive frühkindliche Entwicklung Ihres Kindes in der Kita.
Denn wenn Ihr Kind sich sicher und wohl fühlt, macht es sich auf, seine Umwelt und auch andere Menschen zu erkunden, ist neugierig und gewinnt an Selbstvertrauen.
Mit einer vorübergehenden Trennung von Ihnen als Hauptbezugsperson kann Ihr Kind dann problemlos umgehen und sie akzeptieren.
Gerne begleiten wir Sie und Ihr Kind mit viel Herz und Kompetenz auf diesem Weg!
Haben Sie noch Fragen? Wir sind sehr gerne für Sie da!
Ihr Tausendfüßler Kita-Team
Übergänge gut gestalten und begleiten
Zu den Entwicklungsaufgaben eines Kindes gehört es, im Laufe seiner Bildungsbiografie Übergänge zu bewältigen: vom Elternhaus in die Krippe oder zur Tagesmutter, von der Krippe in den Kindergarten, von der Kita in die Schule.
Unsere zukünftigen Kitakinder kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in unsere Einrichtungen. Machen einige Kinder hier zum ersten Mal die Erfahrung, sich aus familiären Bezügen zu lösen, so sind andere schon „alte Hasen“ und sehr vertraut mit dem Abschiednehmen von Mutter/Vater, da sie aus der Krippe oder von der Tagesmutter in den Kindergarten wechseln. Für alle Kinder ist der neue Beziehungsaufbau das zentrale Thema in den ersten Kitawochen.
Übergang Krippe – Kindergarten
Für die Kinder, die aus unseren Krippen in den Kindergarten wechseln, gibt es ein festgelegtes Verfahren für den Übergang in den Kindergarten. Gut begleitet durch die Pädagog:innen kommen unsere Krippenkinder bereits ein halbes Jahr vor dem Wechsel zum ersten „Schnuppern“ und natürlich zum Spielen in den Kindergarten. Eine erste vorsichtige Hinwendung auf den bevorstehenden Wechsel und die neue Umgebung ist damit getan. Mehrmalige Besuche der Krippenkinder gemeinsam mit ihrer Gruppenpädagogin ermöglichen ein erstes Kennenlernen der neuen Bezugspersonen und der Kindergartengruppe in einem geschützten Rahmen. Die intensive Zusammenarbeit der Pädagog:innen aus Krippe und Kindergarten sowie die Kenntnis der jeweiligen Arbeitsfelder ermöglichen einen an den Entwicklungsbesonderheiten der Kinder orientierten Austausch vor und während des Überganges.
Wie geht es den Eltern dabei?
Unseren Familien gibt dieser gut vorbereitete und durchgeführte Übergang Sicherheit, denn auch Eltern müssen den Übergang von der Krippe in die Kita bewältigen. Eltern erleben den Wechsel von der sehr behütenden und familiären Krippenbetreuung in den lebhaften und offenen Kindergarten möglicherweise als beunruhigend. Um Verunsicherungen bei den Eltern zu vermeiden, laden wir alle Krippeneltern rechtzeitig im Herbst zu einem Informationselternabend ein, auf dem wir ausführlich über die bevorstehenden Veränderungen, die unterschiedlichen Rahmenbedingungen von Krippe und Kindergarten und die konzeptionelle Arbeit im Kindergarten berichten. Wir nehmen uns gerne viel Zeit für alle Fragen der Eltern.
Wir freuen uns, wenn die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind zu den angebotenen Schnuppernachmittagen in den Kindergarten kommen, am Alltag teilnehmen, die neuen Bezugspersonen und Freunde ihres Kindes kennenlernen und ein wenig Kindergartenluft „schnuppern“.
Im Erstgespräch mit den Eltern und der pädagogischen Fachkraft der Kindergartengruppe wird gemeinsam besprochen, wie die Eltern den Übergang ihres Kindes gut mitgestalten können. So bieten wir den Kindern die bestmöglichen Startvoraussetzungen in der neuen Umgebung.
Der Wechsel eines Kindes von einer Bildungseinrichtung in die nächste ist immer mit großen Veränderungen verbunden. Übergänge bedeuten immer, sich mit neuen Anforderungen auseinanderzusetzen und die eigene Rolle neu zu definieren. So wird aus einem Krippenkind ein Kindergartenkind, aus dem Kindergartenkind ein Schulkind.
Ein fachlich fundiertes und auf jede Familie individuell abgestimmtes Eingewöhnungskonzept für neu aufzunehmende Kinder, ein intensiv vorbereiteter und begleiteter Übergang der Krippenkinder in den Kindergarten und ein guter Übergangsprozess von der Kita in die Grundschule bzw. Horteinrichtung sind Qualitätsmaßstäbe in unseren Einrichtungen.
Themenfelder unserer pädagogischen Arbeit
Die anregungsreiche Umgebung
Unsere Kindertagesstätten sind für Kinder gemacht. Hier bekommt man große Lust, sich zu bewegen, viele spannende Dinge auszuprobieren und immer wieder Neues zu entdecken. Viel Licht, fröhliche Farben und eine liebevolle Ausgestaltung gehören dazu und natürlich ein anregungsreicher großer Naturspielplatz, der bei jedem Wetter intensiv genutzt wird.
Der Naturspielraum am Beispiel der Kita Tausendfüßler Krückauring in Kaltenkirchen erstreckt sich rund um das gesamte Gebäude.
Mit den Rollern los düsen klappt wunderbar auf den plattierten Flächen und Wegen. Die Sandkisten bieten Platz zum Buddeln und Bauen, spannende Klettermöglichkeiten machen unsere Kinder zu Kletterkünstlern, die ihre Geschicklichkeit üben und dabei enorm an Selbstvertrauen gewinnen. Die Baustelle mit verschiedenen Materialien bietet viel Raum für das Gestalten verschiedener Bauwerke, an denen hier mit großer Ausdauer gearbeitet wird.
Die Kinder erleben im Rhythmus der Jahreszeiten die Natur ganz nah in dem bewusst naturnah gestalteten Außenspielbereich. Ob Sonnenschein, Regen oder Schnee – der Garten wird an jedem Tag intensiv genutzt.
Buchen- und Weidentunnel sind tolle Höhlen zum Verstecken und auf den dicken Baumstämmen kann man wunderbar klettern und balancieren. Das hügelig angelegte Gelände gibt jede Menge Raum zum Krabbeln, Rutschen und Robben. So werden alle Sinne spielerisch in freier Bewegung geschult und trainiert und das bei jedem Wetter!
Reiche Ernte versprechen die großen Apfel- und Kirschbäume. Hier wird direkt vom Baum geerntet und natürlich auch gegessen. Gemeinsam mit den Pädagog:innen beobachten die Kinder auch das Wachstum der Beerensträucher von der Blüte bis zur Ernte. Die Ernte der Johannis- und Stachelbeeren übernehmen Groß und Klein gemeinsam. Daraus wird köstliche Marmelade gekocht.
Mit Beteiligung der Kinder und Eltern werden die Naturräume unserer Kitas laufend gestaltet. Planungen und daraus folgende Umsetzungen werden sorgsam mit dem Träger entwickelt und möglichst gemeinschaftlich mit Eltern, Kindern und Mitarbeiter:innen umgesetzt.
Bei den Kita-Gartentagen im Frühjahr und Herbst legen Eltern, Kinder und Mitarbeiter:innen Hand an, um die Anlagen gemeinschaftlich zu pflegen. Neben dem Spaß am gemeinsamen Handeln werden vor Ort neue Ideen entwickelt, welche Spielbereiche „optimiert“ werden können.
Besondere Raumkonzepte …
mit Speiseraum, Bewegungshalle, Rollenspielbereich, Wasserlabor, Kreativwerkstatt, Bau- und Puppenecke, Lernwerkstatt und Hochebene sowie verschieden Experimentierstationen bieten unseren Kindern reichhaltige Möglichkeiten, selbstständig tätig zu werden, sich auszuprobieren, auf unterschiedlichste Art und Weise auszudrücken und der Fantasie im Spiel freien Lauf zu lassen.
Bewusst gestaltete Raumschwerpunkte ermöglichen es den Kitakindern, in der Freispielzeit auf Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsame Spielideen zu entwickeln.
Dabei regt ein ästhetisches, qualitativ hochwertiges und nach Bedarf wechselndes Materialangebot die vielfältigen Selbstbildungsprozesse an und fordert das „Selbsttätig werden“ der Kinder heraus.
Auf der anderen Seite sind es immer wieder die einfachsten Dinge, die Kinder anregen und faszinieren.
Beispiele dafür lassen sie jeden Tag entdecken…
Gemeinschaft erleben
Spielen, Streiten, Versöhnen, Lernen – im Kita-Alltag erweitern Kinder täglich ihre sozialen Kompetenzen, sie lernen Konflikte in sozial verträglicher Weise auszutragen und miteinander auszukommen.
Der Erwerb von Handlungsstrategien im Umgang miteinander, das Finden der eigenen Position in der Gruppe, sich dabei für eigene Ideen einsetzen und Kompromisse aushandeln, eigene Bedürfnisse erkennen und diese zu äußern sind elementare Lernerfahrungen in der frühen Kindheit.
Unsere fachkompetenten Pädagog:innen fungieren dabei als sensible und feinfühlige Vorbilder und Entwicklungsbegleiter, die jederzeit für die Kinder da sind und das erforderliche oder notwendige Maß an Unterstützung und Hilfestellung anbieten.
So unterstützen unsere Kindertagesstätten jedes Kind auf seinem Weg, sich zu einer verantwortungsvollen, selbstbewussten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu entwickeln.
Spielen und lernen
Kinder sind hungrig nach Wissen und neuen Erfahrungen.
Ihre Themen zu erkennen, ihnen im Alltag immer wieder neue Anreize und Impulse für ihre Weiterentwicklung zu geben, sich gemeinsam mit ihnen forschend auf unbekannte Prozesse einzulassen, ist Hauptaufgabe der pädagogischen Fachkräfte.
Bildung hat immer mit innerer Motivation, mit Begeisterung und Eigensinn zu tun. Daher hat das freie Spielen in anregungsreicher Umgebung, bei gutem oder schlechtem Wetter, in Innen- oder Außenräumen, in unserer Kita einen hohen Stellenwert. Spielangebote sind immer Bildungsangebote, bei denen das Kind Leistungsmotivation und Arbeitshaltung entwickelt. Die Anlagen dazu stecken bereits in ihm; es will selbst forschen und entdecken.
Mit vielseitigen und an den Themen der Kinder orientierten Projekten und Angeboten erfüllen wir den vom Land Schleswig-Holstein festgelegten Bildungsauftrag für Kindertagesstätten.
Wie Kinder lernen
Bildung ist ein lebenslanger Prozess und beginnt mit der Geburt. Von Beginn an setzen sich Kinder kompetent, aktiv und neugierig mit der Welt auseinander. Sie lernen durch Bewegung, durch „Selbsttätig werden“, Ausprobieren und Experimentieren, durch Begreifen. So entwickeln sie nach und nach ein Verständnis davon, wie die Welt beschaffen ist und welche Bedeutung sie in dieser Welt haben. Kinder entdecken die Welt ganzheitlich und mit allen Sinnen.
Dazu brauchen sie ein förderliches Umfeld, das es ihnen ermöglicht, sich ihren spezifischen Entwicklungsthemen zuzuwenden und Erwachsene, die ihnen Zeit geben und sie im erforderlichen Maße in der Entfaltung ihrer Kompetenzen und Fertigkeiten unterstützen.
„In der Vielfalt des Alltags lernen sie zu kommunizieren und zu sprechen, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, soziale oder mathematische Probleme zu lösen, die Natur zu entdecken, nach dem Sinn des Lebens zu fragen und vieles mehr. Dabei entsteht Stück für Stück ihr Bild von der Welt, auf dem alles spätere Denken und Fühlen aufbauen wird.“
Aus „Erfolgreich starten“ – Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein
Freispielzeit – Selbstbestimmte Zeit
Ein Kita-Tag ist klar strukturiert und unterteilt sich in Freispielzeiten und Gruppenzeiten.
In den Freispielzeiten können die Kinder selbst entscheiden, in welchen Bereichen der Kita sie sich aufhalten und spielen möchten. Unsere Kinder wählen in der Freispielzeit zwischen verschiedenen attraktiven „Funktionsbereichen“ wie z. B. Experimentierecken, Wasserlabor, Bauecken, Taschenlampenhöhle, Lernwerkstatt, Puppenecke oder Rollenspiel- und Verkleidungsbereich.
Die konzipierten Bewegungsangebote in der Halle gehören zu den weiteren breitgefächerten Möglichkeiten, die unsere Kinder im Laufe eines Kindergarten-Tages nutzen können.
Nach einer Phase der Orientierung finden sie eine für sie wichtige und interessante Spielsituation, der sie sich zuwenden. Sie werden darin unterstützt, nach ihren Interessen und Bedürfnissen zu entscheiden mit wem, was, wo und wie lange sie spielen.
Wir ermutigen sehr bewusst die Kinder, wahrzunehmen, was für sie gerade wichtig ist. Dazu gehört es Kompromisse auszuhandeln, wenn z. B. der beste Freund etwas Anderes spielen möchte, oder auch neu zu planen, wenn der bevorzugte Spielbereich gerade belegt ist. Die Kinder erweitern so ihre Kenntnis über ihre eigenen Bedürfnisse, erfahren die Auswirkungen der von ihnen getroffenen Entscheidungen und werden kindgerecht in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt.
Bedeutung von Strukturen und Regeln
Ein klar strukturierter Tagesablauf mit immer wiederkehrenden Ritualen und Abläufen gibt unseren Kindern Orientierung und Sicherheit. Der Wechsel zwischen selbstbestimmter Zeit und verbindlichen Gruppenzeiten strukturiert den Kita-Tag und hilft den Kindern, sich in der komplexen Welt der Kita zurechtzufinden. Klare und – wo möglich – gemeinsam erarbeitete Regeln helfen dabei, das Zusammenleben im Alltag für alle nachvollziehbar und verlässlich zu gestalten.
Ebenso wie die Pädagog:innen Regeln immer wieder auf ihre Sinnhaftigkeit und ihre Notwendigkeit im Alltag überprüfen, stellen auch Kinder bestehende Regeln in Frage. Gemeinsam gilt es, zu diskutieren und ggf. neue tragfähige Lösungen oder Kompromisse zu erarbeiten. Immer wieder ist es erstaunlich, mit welcher Umsicht und Kreativität die Kinder zu pragmatischen Lösungswegen finden. Eine gemeinsam von Kindern und Pädagog:innen ausgehandelte Regelung hat eine viel größere Akzeptanz und Tragfähigkeit als eine ausschließlich von Erwachsenen bestimmte Maßnahme.
Malen und gestalten
Unsere Kitakinder arbeiten und experimentieren liebend gerne mit unterschiedlichen Farben und Materialien, die ihnen von unseren Pädagog:innen zur Verfügung gestellt werden. Damit können die Kinder vielfältige künstlerische Techniken ausprobieren und weiterentwickeln.
Häufig werden nur wenige Farben eingesetzt, um ein intensives Farberleben zu ermöglichen.
Ziel ist, die Freude der Kinder am Umgang mit unterschiedlichen Farben und Materialien zu fördern.
Beim freien Malen und Gestalten werden Kreativität und Phantasie gefördert, die Feinmotorik wird geschult sowie die Auge- Handkoordination geübt.
Auch kognitive Fähigkeiten werden weiterentwickelt, z. B. durch experimentelle Erfahrungen oder durch spannende Vergleiche mit der Realität.
Allzu oft werden Kinder viel zu früh aufgefordert, gegenständlich zu malen, obwohl sie ihrem Entwicklungsstand nach noch gar nicht dazu in der Lage sind. Kindliche Erlebnisse können über das Malen verarbeitet, Spannungen abgebaut werden – vorausgesetzt die Malentwicklung wird durch Erwartungen und Korrekturen nicht gestört.
„In der kreativen und gestalterischen Tätigkeit sehen wir eine Methode, mittels der sich die Menschen aktiv und bewusst mit ihren Erlebnissen und ihrer Umwelt auseinandersetzen. Im kreativen Tun können Verständigungsprozesse durchlaufen werden, die sprachlich noch nicht auszudrücken sind.
Kinder finden im Gestalten Ausdrucksformen, um ihre verschiedenen Interessen, Ansprüche und Bedürfnisse zu artikulieren. Sie können Wünsche oder Erlebnisse, für die sie noch keine Worte finden, in Bildern umsetzen. Kreatives Gestalten ermöglicht es, zu reflektieren und auf sich selbst zu schauen.“
KLAX, Päd. Prinzipien, Berlin
Musik, Tanz und Rhythmik
Im Vordergrund unserer pädagogischen Arbeit steht in diesem Aufgabenbereich die Freude der Kinder am eigenständigen Musizieren und Komponieren, Experimentieren und Entwickeln von Rhythmen.
Beim gemeinsamen Singen und Tanzen in der Kleingruppe oder im großen Kita-Kreis kommen auch Musikinstrumente zum Einsatz. Bei den Gruppenerlebnissen lernen die Kinder aufeinander einzugehen und andere aktiv wahrzunehmen.
Die Sinne „Hören“ und „Sehen“ werden dabei angesprochen, die motorischen Fähigkeiten geschult.
Der Einsatz von Musik in der Kita fördert:
- die Fähigkeiten der Kinder zur Selbstäußerung
- die Kontaktaufnahme und die Kommunikation der Kinder untereinander
- das kindliche Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein
- die Wahrnehmung des Körpers sowie
- die Konzentrationsfähigkeit der Kinder
Bewegte Kinder
Was sollten Kinder in welchem Alter können? Einen Purzelbaum schlagen, einen Ball werfen oder auffangen, vielleicht schon Seilspringen oder Radfahren?
Bei den oben genannten Beispielen handelt es sich um kindliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es zu entwickeln gilt und die wir in der Kita bewusst durch Bewegungserziehung individuell aufbauen möchten.
Bewegung gehört in unseren Kitas zu den vielen alltäglichen Aktivitäten, sei es in der Bewegungshalle, beim Spiel im Naturspielbereich oder bei Exkursionen.
Durch und in Bewegung erprobt das Kind seinen Körper; es lernt mit ihm umzugehen (Koordination, Reaktion und Balance) und ihn einzuschätzen. Körperliche Erfahrungen ermöglichen, die eigene Identität zu begreifen und Vertrauen in die eigene Person zu entwickeln. Der Begriff des eigenen Körperschemas kann sich so bilden, das Kind bekommt eine Vorstellung von Raum und Zeit bezogen auf die eigene Person und die eigene Umgebung. Kinder erfahren sich im Bewegungsspiel. Sie lernen soziale und körperliche Grenzen kennen, begegnen Schwierigkeiten und entdecken Möglichkeiten, diese zu lösen.
In unseren Bewegungsangeboten werden vielfältige Aspekte der Bewegungserziehung aufgegriffen. Hierbei stehen das gemeinsame Tun, das Miteinander- oder Gegeneinander-Spielen sowie die Absprache mit anderen im Vordergrund.
Auch das Gefühlsleben der Kinder wird dabei angesprochen; Gefühle wie Freude, Erschöpfung, Lust und Unlust, Kraft und Energie, Mut und Entspannung werden durch gezielt gelenkte oder freie Bewegung erlebt.
Dabei gilt es, ihre aktuellen Bedürfnisse und Interessen zu berücksichtigen und die Kinder an der Planung zu beteiligen.
Entwicklung Dokumentieren
Grundlage für die pädagogische Arbeit ist eine sensible und differenzierte Beobachtung der Kinder durch die Pädagogischen Fachkräfte.
Während eines Kitatages bieten sich dafür vielfältige Möglichkeiten, die von den Fachkräften bewusst genutzt werden. Durch aktives Zuhören im feinfühligen Dialog mit den Kindern erkennen sie die individuellen Themen der Kinder und tragen durch gezielte Impulse und Anregungen zu einer Erweiterung der kindlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten bei.
Um die Entwicklung jedes Kindes fachlich solide zu dokumentieren, haben wir einen umfangreichen und detaillierten Arbeitsbogen entwickelt, der die individuellen Schritte der kindlichen Entwicklung über die gesamte Kita-Zeit eines Kindes dokumentiert. Diese Entwicklungsdokumentation dient als Arbeitsgrundlage für die Planung der pädagogischen Arbeit mit dem Kind und der Gestaltung geeigneter Förder- bzw. Unterstützungsangebote. Verbindlich festgelegte Beobachtungszeiträume gewährleisten eine zuverlässige Wahrnehmung der Entwicklungsprozesse der uns anvertrauten Kinder.
Regelmäßig angebotene Entwicklungsgespräche zwischen den Eltern und den Pädagogischen Fachkräften bilden die Basis für eine gute Zusammenarbeit bei der Begleitung der vielfältigen Entwicklungsthemen des Kindes. Dabei dient die vorliegende Dokumentation als aussagekräftiger Leitfaden und zeigt detailliert die Entwicklung des Kindes in den vergangenen Monaten. Gleichzeitig bietet die Dokumentation eine wichtige Gesprächsgrundlage für den Austausch zu den Stärken des Kindes und einem eventuell notwendigen Unterstützungsbedarf beim Erlangen von Wissen, Erwerb bestimmter Fähigkeiten und Fertigkeiten oder sozialer Kompetenzen.
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
Sprache ist die grundlegende Kompetenz, um einander zu verstehen, sich mitteilen zu können und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dabei setzen Sprache und Sprechen eine gesunde Entwicklung des Gehirns, der Sprechorgane, eine intakte Hörfunktion und visuelle Fähigkeiten, Wahrnehmung und deren Verarbeitung, kognitive sowie motorische Fähigkeiten und soziale Kontakte, Liebe sowie Wärme voraus. Sprache ist ein individuelles Grundbedürfnis eines jeden Menschen.
In den fachlichen Diskussionen wird dem frühen Sprachentwicklungsprozess in den Settings Familie und Kita eine entscheidende Bedeutung beigemessen. Mehrsprachigkeit und individuell unterschiedliche Sprachentwicklung stellen Kita-Fachkräfte vor die anspruchsvolle Aufgabe, Sprache in den Fokus der frühkindlichen Bildung zu rücken.
Die Bundesregierung hat mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ die notwendige Qualifikation der Kita-Fachkräfte, um alltagsintegrierte Bildung, inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit den Familien in den Kindertagesstätten gefördert.
Die Tausendfüßler Stiftung nimmt am Bundesprogramm seit 2016 teil.
Die Tausendfüßler Stiftung setzt mit den Mitteln des Bundesministeriums eine ausgebildete Sprach-Fachkraft ein, die in Absprache mit der Teamleitung verantwortlich für die inhaltliche Umsetzung des Programms in der Einrichtung ist. Der Prozess wird durch die Fachbereichsleitung und die Qualitätsbeauftragte der Tausendfüßler Stiftung begleitet. Unterstützt wird die Fachkraft von einer externen Fachberatung.
Der Schwerpunkt Sprachförderung wird durch diese Qualitätsoffensive in allen Tausendfüßler Kitas auch nach Beendigung des Bundesprogramms weiterentwickelt.
Zu den Aufgabenfeldern unserer Sprach-Fachkraft als sogenannter Multiplikatorin zählen die Begleitung und die Schulung der Teams zu den drei Hauptsäulen des Bundesprogramms:
- Alltagsintegrierte sprachliche Bildung
- Inklusive Pädagogik
- Zusammenarbeit mit Familien
Ihre Aufgabe ist es, alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit in den Einrichtungen zu verankern. Alltägliche Situationen und Gelegenheiten im Kitaalltag sollen bewusst und systematisch für die Unterstützung und Förderung der sprachlichen Entwicklung der Kinder genutzt werden. Im Kitaalltag unterstützt sie die Teams mit ihrem fachlichen Knowhow und trägt zur Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption der Tausendfüßler Kitas bei.
Die Verbundtreffen und Arbeitskreise des Regionalverbundes der Sprach-Kitas tragen letztendlich zur fachlichen Weiterentwicklung aller Fachkräfte in unseren Kitas bei, da die Sprach-Fachkraft die Informationen und das Fachwissen in den Teambesprechungen der Kitas regelmäßig an die pädagogischen Kitakräfte weitergibt.
Was heißt alltagsintegrierte sprachliche Bildung?
Die Unterstützung der Sprache ist durchgängiges Prinzip zur Gestaltung des Alltags in unseren Kitas. Sie knüpft dabei an die aktuellen Bedürfnisse, Interessen und den aktuellen Entwicklungsstand der Kinder an. Sprache steckt in jedem Kontakt. Die Fachkraft für Sprach-Kita unterstützt die alltagsintegrierte sprachliche Bildung, indem sie verschiedene Angebote zur sprachlichen Bildung initiiert. Sie nutzt hierzu ihr Fachwissen und geht in den Dialog mit den pädagogischen Fachkräften. Im Austausch mit der Sprach-Fachkraft werden sich die Fachkräfte ihrer Rolle als Sprachvorbild bewusster, schaffen Rahmenbedingungen für Sprachanlässe und nutzen vielfältige Methoden für die sprachliche Bildung im Alltag.
Die systematische Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Entwicklung der Kinder dient dabei als Grundlage für die Gestaltung angemessener Angebote und zum Austausch sowohl im Team als auch mit den Eltern. So kann der Sprach-entwicklungsprozess der Kinder optimal gestaltet werden. Eingesetzt werden dabei.
- Bücher, Fingerspiele, Lieder in verschiedenen Sprachen
- Projektarbeiten zur Identitätsentwicklung, wie z. B. „Das bin ich – Das bist du – Das sind wir“ mit anschließender Präsentation der Ergebnisse, um mit Kindern und Eltern ins Gespräch zu kommen
- die „Bücherkiste“ mit Verleihoption, um den Kindern den Zugang zu Büchern im häuslichen Umfeld zu ermöglichen und ihre Interessen mit den Familien zu kommunizieren
- dialogisches Lesen, d. h. anders als beim klassischen Vorlesen stehen hier die Redebeiträge der Kinder im Mittelpunkt
- das Erzähltheater „Kamishibei“, das insbesondere die fiktiven Erzählfähigkeiten der Kinder fördert
- Materialien und Spiele, die die selbstbestimmte Auseinandersetzung der Kinder mit Sprache ermöglichen
- vielfältige Sprachanlässe im Kitaalltag
- die sprachliche Vorbildfunktion der Kitakräfte
Sprachförderung und inklusive Pädagogik „Wir sind Ich & Du und alle dazu“
Eine wertschätzende, von Offenheit geprägte und empathische Grundhaltung bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung inklusiver Pädagogik. Inklusive Pädagogik findet sich in den wechselnden Interaktionen zwischen Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften durchgehend im Kita-Alltag wieder.
Sie wird in unseren Sprach-Kitas sichtbar durch:
- unsere Willkommenskultur
- mehrsprachige Begrüßung der Familien über einen entsprechenden Aushang
- Einsatz von Dolmetschern bei Bedarf
- Bereitstellung allgemeiner Elterninformationen in verschiedenen Sprachen
- Einsatz mehrsprachiger Bücher
- Vorlesetage mit Eltern in ihrer Muttersprache
- Spielmaterial aus den Kulturen der Herkunftsländer der Kinder
- Teilnahme der Kita-Fachkräfte an themenspezifischen Fortbildungen
- Einsatz von mehrsprachigen Fachkräften
Sprachförderung und Eltern
Um eine gelingende Zusammenarbeit in der Kita leben zu können, müssen Familien in ihrer Verschiedenheit, ihrer Lebensweise und ihren kulturellen Maßstäben akzeptiert und wertgeschätzt werden. Das erfordert einen differenzierten Wissensstand sowie eine Selbstreflektion unserer Kita-Fachkräfte. Die Zusammenarbeit wird von Seiten der Kitas vielfältig initiiert und findet in vielen Bereichen und in unterschiedlicher Form statt, beispielsweise
- Einladung zu gemeinsamen Morgenkreisen und Hospitationen
- Gestaltung gemeinsamer Vorlesetage mit den Eltern
- Einzelaktivitäten von engagierten Eltern (z. B. Backen mit den Kindern)
- Gestaltung der Elternabende in leichter Sprache mit Einsatz von Bildmaterial
- Einsatz von Piktogrammen oder Dolmetschern
- gemeinsame Planung und Durchführung von Festen mit den Eltern
Ziel ist es, die individuellen Ressourcen der Eltern kennen zu lernen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich in die Prozesse der Kita aktiv einzubringen. Mit den verschiedenen Angeboten für Familien sollen die Besonderheiten möglichst aller Familien berücksichtigt werden.
Die Eltern erhalten über ihre Kinder in der Kita die Möglichkeit, sich unmittelbar mit Interkulturalität und gesellschaftlicher Vielfalt auseinanderzusetzen. Alle Eltern in unseren Kitas werden über die Inhalte und Umsetzung der Sprachförderung gut informiert.
Sexualpädagogik
Junge* sein, Mädchen* sein, Nacktheit und Doktorspiele – Kinder haben ein Interesse an ihrem Körper, entdecken, erforschen und benennen Unterschiede der Geschlechter.
Kindliche Sexualität äußert sich vor allem in dem Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und sinnlicher Nähe, der Freude und Lust am Körper.
Zu einer ganzheitlichen Entwicklung der Kinder gehören die Entdeckung und Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und dem eigenen Geschlecht. Dazu trägt eine sexualfreundliche Erziehung maßgeblich bei. Sie beinhaltet, Fragen der Kinder altersgemäß zu beantworten und durch eine geschützte und liebevolle Atmosphäre die Experimentierfreude und Erlebnisse rund um den Körper und die Sinne zuzulassen.
Sexualfreundliche Erziehung ist auch Sozialerziehung. Nur wenn ein Kind sich selbst, seinen Körper und seine Grenzen kennt, ist es in der Lage, die Grenzen anderer zu respektieren.
Kinder bringen ihre Sexualität und die gemachten Erfahrungen schon mit in die Einrichtung.
Wir möchten durch unsere pädagogische Arbeit in der Kita:
- die Kinder in der Wahrnehmung ihrer Gefühle fördern
- die Kinder sensibilisieren, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer Menschen zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren
- dass die Kinder ihren eigenen Körper wahrnehmen und akzeptieren
- dass die Kinder körperliche oder sexuelle Sachverhalte angemessen ausdrücken können, ohne andere zu beleidigen oder zu verletzen
- dass Kinder die eigene Sexualität als einen positiven Lebensbereich bejahen
Diese Sexualpädagogik trägt dazu bei, das kindliche Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und selbstbestimmte Handeln zu stärken.
Ein in diesem Sinne aufgeklärtes und selbstbewusstes Kind kann sich auch vor sexuellen Übergriffen besser schützen und ist in der Lage, sich Hilfe zu holen.
Bildung für nachhaltige Entwicklung
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung verstehen wir als übergreifende Aufgabe für alle Bildungsbereiche in unseren Kindertagesstätten. Kreativität, Querdenken, Offenheit anderen Menschen und neuen Situationen gegenüber sind wichtige Voraussetzungen, die in den Bildungsprozessen gefördert werden. Ziel einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wird mit „Gestaltungskompetenz“ für eine nachhaltige Entwicklung ausgedrückt.
Umweltbildung und Schaffung eines Bewusstseins, Verantwortung für die Konsequenzen des eigenen Verhaltens zu übernehmen, beginnt schon bei den ganz Kleinen. Kinder sind neugierig, wissensdurstig und begeisterungsfähig und sie beginnen frühzeitig, sich ein Bild von der Welt zu machen. Die Grundlage für Werte und Haltungen, u. a. auch zu umweltrelevanten Fragen, wird bereits in der frühen Kindheit gelegt. Was sich Menschen in der frühen Kindheit an Grundfertigkeiten, Werthaltungen und Überzeugungen aneignen, spielt eine große Rolle dafür, wie sie sich in ihrem weiteren Leben, ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt gegenüber verhalten.
Im alltäglichen Zusammenleben in der Kita bieten insbesondere die gemeinsame Vorbereitung und das gemeinsame Essen, der Einkauf dafür, aber auch das Funktionieren von Ver- und Entsorgung, Reinigung und Verkehr vielfältige Anlässe für Bildungsprozesse im Sinne einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Gedanken der Nachhaltigkeit stärker in unseren Alltag einzubinden, hier im Besonderen die Kinder sensibel zu machen für die Umweltthemen, die für sie als nachwachsende Generation relevant sein werden. Dazu gehören eine bewusste Auseinandersetzung mit unserer Haltung zu Klima- und Umweltschutzfragen und die Entwicklung gemeinsamer Handlungsleitlinien, die einen schonenden und bewussten Umgang mit unseren Ressourcen beinhaltet.
Nur was wir schätzen, können wir auch schützen!
Gesunde Ernährung
Kinder werden in unseren Einrichtungen je nach Betreuungsumfang über Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack und Abendessen komplett verpflegt, d. h. die Eltern werden in der Versorgung ihrer Kinder entlastet.
Unsere Verantwortung liegt darin, für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung als Grundlage für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung unserer Kinder zu sorgen.
Müsli- und Cornflakes, Milch, Frucht- und Naturjoghurt, Mandeln und Rosinen sowie frisches Brot vom ortansässigen Bäcker, Wurst, Käse, Frischkäse, Marmelade oder Honig werden an verschiedenen Wochentagen angeboten. Da ist für jedes Kind etwas Schmackhaftes dabei. Das Mittagessen wird kombiniert aus Frischkost und kindgerechten TK Fertigprodukten, die in unseren Küchen erwärmt bzw. gegart werden. Salate, Saucen, Kartoffeln oder Nudeln werden frisch zubereitet. Alternativ wird eine unserer großen Kitas über einen Caterer beliefert, der unsere Qualitätsansprüche erfüllt.
Ein abwechslungsreicher Snack sorgt dafür, dass auch am Nachmittag die Energie unserer Kinder ungebremst bleibt. Zu allen Mahlzeiten gehören frisch aufgeschnittenes Obst und Gemüse dazu. Ebenso werden Getränke nicht nur zu den Mahlzeiten angeboten, sondern stehen den Kindern stets zur Verfügung.
Kinder haben ein angeborenes Gespür für Hunger und Sättigungsgefühle.
Damit dies nicht verloren geht, muss kein Kind seinen Teller leer essen oder Dinge probieren, die es nicht mag. Stattdessen ermuntern wir unsere Kinder, zu probieren und achten darauf, dass sich jeder zunächst eine kleine Portion auffüllt und dann nach Bedarf nachnimmt. So macht das Essen Spaß und jeder wird satt!
Dabei legen wir übrigens auch Wert auf eine kindgerechte Tischkultur.
Inklusion – Jede:r ist willkommen!
Unsere Welt ist bunt und vielfältig. Das spiegelt sich auch in unseren Kindertageseinrichtungen wider, Vielfalt sehen wir als große Chance für uns alle.
Jedes Kind ist einzigartig, unabhängig von Geschlecht, sozialer Herkunft, Alter, Entwicklungsstand, kulturellem Hintergrund, und entwickelt sich in seinem eigenen Tempo. Wir berücksichtigen den individuellen Entwicklungsstand und die Lebenslage des Kindes, heben eventuelle Barrieren auf und passen unsere Bildungsangebote sowie die Lernumgebung den Bedürfnissen und Interessen des Kindes stetig an. So wollen wir allen Kindern eine soziale Teilhabe und einen gleichberechtigten Zugang zur Bildung ermöglichen.
Unser Ziel ist es, die Kinder dabei zu unterstützen, zu selbstbestimmten Persönlichkeiten heranzuwachsen, um Beeinträchtigungen und Diskriminierung entgegenzuwirken. Wir dokumentieren die Entwicklung der Kinder, orientieren uns dabei an ihren Stärken und ermöglichen eine individuelle und bedürfnisorientierte Begleitung.
So vielfältig wie unsere Kinder und ihre Familien sind auch unsere Teams. Multiprofessionell aufgestellt bringen sie unterschiedliche religiöse, kulturelle, sprachliche und sexuelle Orientierung mit. Auch körperliche Beeinträchtigungen unserer Kolleg:innen spiegeln die Offenheit und das Selbstverständnis der Tausendfüßler Stiftung als Arbeitgeber und Träger wider.
Wir verstehen Inklusion als einen Prozess, der sich stetig weiterentwickelt, indem wir immer wieder unsere Haltung zu einer vorurteilsbewussten Erziehung überprüfen, an themen-spezifischen Fortbildungen teilnehmen, unsere Bildungsangebote und die Kita-Räumlichkeiten den Bedürfnissen der Kinder (und Mitarbeitenden) anpassen und dabei vielfältiges pädagogisches Material einsetzen. Unsere pädagogischen Inhalte orientieren sich dabei
- an vorurteilsbewusster Pädagogik
- am Bewusstmachen von Diversität/Verschiedenheit
- an unserer Vorbildfunktion
Inklusive Pädagogik ist unser Alltag. Dabei müssen sich Kita-Räumlichkeiten und Außengelände gegenüber den Maßstäben der Barrierefreiheit bewähren und bedarfsgerecht anpassen. Dazu gehört auch bei Bedarf die Bereitstellung für einer medizinisch/therapeutischen Versorgung der Kinder.
Inklusive Pädagogik findet sich in den wechselnden Interaktionen zwischen Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften im Kita-Alltag wieder. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Wir stehen ihnen in allen Lebenslagen begleitend, unterstützend und beratend zur Seite und beziehen sie in die Bildungs- und Entwicklungsprozesse ihrer Kinder mit ein. Dafür ist die Transparenz unserer Arbeit besonders wichtig.
Wir verstehen uns zudem als „Netzwerker“ im Interesse der Kinder und Familien und helfen, Kontakte zu anderen Institutionen und Einrichtungen herzustellen, um auf verschiedenen Ebenen zusammenzuarbeiten. Dazu zählen Heilpädagog:innen, Therapeut:innen, medizinische Einrichtungen, Frühförderstellen, Familienberatungseinrichtungen, etc.
Unsere Grundhaltung (wertschätzend, empathisch, freundlich, aufgeschlossen, neugierig, selbstreflektiert) bildet die Basis für das Miteinander und die Atmosphäre in unseren Kitas. Unsere Haltung zu Vielfalt wird sichtbar durch das mehrsprachige Begrüßen der Familien im Eingangsbereich, die Gestaltung von mehrsprachigen Aushängen, den Einsatz von Dolmetscher:innen bei Bedarf, die Bereitstellung von Elterninformationen in verschiedenen Sprachen, den Einsatz von mehrsprachigen Büchern, Vorlesetage mit Eltern und Mitarbeitenden in ihrer Muttersprache sowie durch Spielmaterial aus den Kulturen der Herkunftsländer der Kinder. Alles signalisiert DU BIST WILLKOMMEN!
Weitere praktische Beispiele:
- Darstellungen und Symboliken zur sichtbaren Orientierung und Strukturierung der Räume
- Präsentation von Spielmaterialien auf Augenhöhe der Kinder
- Materialien und Angebote, die dem Alter und Entwicklungsstand aller Kinder entsprechen
- Beteiligungsprozesse
- Mitbestimmung der Kinder in Alltagssituationen
- Partizipation als Hilfe zur Selbsthilfe (z. B. Treppenaufstieg zur Wickelkommode)
- Kinderpaten helfen anderen Kinder bei der Bewältigung des Kita-Alltags
- Niedrigschwelliges Beschwerdeverfahren für Kinder und Eltern
- Einsatz des „Brückenbauer“ mit Begleitung beim Übergang zur Grundschule bzw. Horteinrichtung
Meine Meinung - deine Meinung
Kinder haben Rechte
Die Rechte der Kinder sind die Grundlage für unsere Arbeit in unseren Kindertagesstätten.
- Recht auf Bildung und Entfaltung der Persönlichkeit
- Recht, so zu sein wie sie sind
- Recht auf Partizipation
- Recht auf Selbstbestimmung
- Recht auf eigene Erfahrungen
- Recht auf verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen
- Recht auf kompetente pädagogische Begleitung
- Recht auf soziale Gemeinschaft
Die Kinder sollen erfahren, dass ihre in der UN-Kinderrechtskonvention beschriebenen und festgelegten Rechte (http://www.kinderrechtskonvention.info/) in unseren Kitas anerkannt und gelebt werden.
So unterstützen wir unsere Kinder darin, selbstständige, selbstbewusste, vorurteilsfreie und verantwortungsbewusste Mitglieder unserer demokratischen Gemeinschaft zu werden.
Für den pädagogischen Alltag bedeutet das, dass Kinder in der Gemeinschaft der Kita soziales Handeln erlernen. Im täglichen Miteinander erkennen sie die Grenzen der eigenen Rechte darin, dass andere Menschen gleichermaßen anzuerkennende und zu respektierende Rechte haben.
In unseren Einrichtungen erfahren die Kinder, was es heißt, eigene Rechte zu haben. Sie erleben, dass diese sowohl für sie selbst als auch für Erwachsene verbindliche Maßstäbe im Umgang miteinander sind.
Siehe Anlage A „Beteiligungsverfahren“
Mithandeln und mitgestalten
In unseren Kitas ermöglichen wir gelebte alltägliche Partizipation, indem wir Kindern zu bestimmten Themen ein klares Mitspracherecht einräumen und ihnen die alters- und entwicklungsgemäße Übernahme von Verantwortung zutrauen. Die Meinungen und Sichtweisen unserer Kinder interessieren uns; ihre Bedürfnisse und Anliegen werden von uns wahr- und ernst genommen.
Für den Kita-Alltag bedeutet das, sogenannte partizipatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, z. B. Konflikte aufzugreifen und gemeinsam Lösungen zu finden, die möglichst alle mittragen können.
Vom ersten Kita-Tag an werden die Kinder in die Gestaltung der Morgenkreise einbezogen. So erleben sie frühzeitig die eigene Selbstwirksamkeit bei Entscheidungen. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei, ihre individuellen Themen in der Gruppe verständlich zu kommunizieren.
Abhängig vom Entwicklungsstand werden sie durch Symbole, Fotos oder mit Hilfe der Sprache angehalten, ihre persönlichen Themen darzustellen, bzw. auszuwählen.
In regelmäßig stattfindenden Abstimmungen in ihrer Stammgruppe oder auch gruppenübergreifend erhalten die Kinder die Möglichkeit, an der Planung des Kitalebens mitzuwirken. Sie lernen, eigene Wünsche zu präsentieren, aber auch, sich den Wünschen der anderen Kinder unterzuordnen.
So können die Kitakinder z. B. freitags im Morgenkreis selbst entscheiden, ob sie an einem Ausflug teilnehmen. Vorbereitete Symbole grenzen die Teilnahme zahlenmäßig ein. Die Kinder sprechen sich untereinander ab und klären bei einer Nichtübereinstimmung, wer beim Ausflug mit dabei ist. Je nach Entwicklungsstand werden sie hierbei von den pädagogischen Fachkräften sensibel begleitetet.
Beteiligungsmöglichkeiten bieten eine gute Grundlage für Absprachen bei auftretenden Konflikten. Je nach Dringlichkeit des Themas werden die Morgenkreise, Gruppenzeiten oder aber Kleingruppen mit den beteiligten Kindern genutzt, um gemeinsam mit den Kindern Handlungsstrategien zu besprechen. Die pädagogischen Fachkräfte ermuntern die Kinder, selbst über die Dringlichkeit ihres Anliegens zu entscheiden und den notwendigen Besprechungsrahmen mitzubestimmen.
Visualisierte Stimmungsbarometer sind hierbei ein gutes Mittel, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen.
Kindgerecht erleben sie erste demokratische Strukturen und wachsen daran, Verantwortung für sich und die soziale Gemeinschaft zu übernehmen.
…in der Freispielzeit
In unseren Freispielzeiten dürfen sich unsere Kitakinder im Haus frei bewegen. Sie können wählen zwischen verschiedenen Funktionsbereichen in den Gruppenräumen. Sie können nach ihren Interessen und Bedürfnissen entscheiden, mit wem, was, wo und wie lange sie spielen. Dabei werden sie ermutigt, Entscheidungen zu treffen, Kompromisse auszuhandeln oder neu zu planen.
…in der Frühstückszeit
In einer festgelegten Zeitspanne können alle Kindergartenkinder morgens frühstücken. Jedes Kind entscheidet nach seinem eigenen Hungergefühl, ob und wann es in den Frühstücksraum geht, um hier von dem reichhaltigen Angebot Gebrauch zu machen.
…in der Gruppenzeit
In der Stammgruppe laden wir die Kinder zum Austausch über ihre Erlebnisse und über besondere Ereignisse ein. Im Gespräch lernen sie sich untereinander besser kennen und das Interesse füreinander entwickelt sich.
Rücksichtnahme im Gesprächsablauf ermöglicht erst einen guten Austausch. Zuhören ist wichtig! Selbstverständlich respektieren wir, wenn sich jemand nicht äußern möchte. Gemeinsam mit den Kindern planen wir in dieser Runde die Kita-Aktivitäten. Abgestimmt wird zum Beispiel über das Kreisspiel, das Thema des nächsten Festes oder wohin der nächste Gruppenausflug gehen soll. Aktuelle Probleme im Miteinander werden hier besprochen und gemeinsam Lösungen ausgehandelt.
Beschweren erwünscht
Die Tausendfüßler Stiftung hat für ihre Kindertagesstätten ein Beschwerdemanagement entwickelt, passgenau für Kinder, Eltern und Mitarbeitende.
Für den Kita-Alltag bedeutet das, sogenannte partizipatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, Konflikte aufzugreifen und gemeinsam Lösungen zu finden, die möglichst alle mittragen können.
Wir verstehen Beschwerden – egal ob sie von Kindern, Eltern oder Kolleg:innen kommen – als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung. Beschwerden bieten ein Lernfeld und eine Chance, Beteiligung umzusetzen. Beschwerden und Beteiligung bedingen sich gegenseitig. Unser umfangreiches und zielgruppenspezifisches Beschwerdemanagement bietet allen einen unkomplizierten Zugang zu Beschwerdemöglichkeiten.
Siehe Anlage B „Beschwerdemanagement“
Unsere Feste
In unseren Kitas feiern wir traditionelle Feste sehr gerne gemeinsam mit den Familien unserer Kitakinder. Bereits die Vorbereitungen werden gemeinsam mit den Kindern und den Eltern in Angriff genommen. Die Vorfreude auf den besonderen Tag in der Kita ist für alle erlebbar.
Faschingsfest
Zu Beginn des Jahres geht es los mit unserem Faschingsfest. Am Freitag vor Rosenmontag erobern Clowns, Cowboys, Prinzessinnen, Hexen und viele kleine bunte Gestalten den Kindergarten. An Stelle des sonst üblichen Frühstücks gibt es ein von den Eltern zusammengestelltes Büfett, das zum gesunden Schlemmen einlädt. Es werden verschiedene spannende oder auch knifflige Spiele angeboten und Groß und Klein tanzen und singen fröhlich zusammen in der Bewegungshalle. Höhepunkt ist in jedem Jahr die große Modenschau mit den bunten Kostümen.
Ostern
Ostern gestalten wir am Gründonnerstag in Form eines gemeinsamen Osterausflugs zu einem der Spielplätze in der näheren Umgebung. Ein Picknick mit selbst gefärbten Ostereiern gehört hier genauso dazu wie Eierlaufen und Sackhüpfen. Die abschließende Ostereisuche, bei der es einiges zu entdecken gibt, rundet diesen bunten Vormittag ab.
Sommerfest
Gemeinsam mit allen Familien feiern wir unsere Sommerfeste, die vorher gemeinsam mit den Eltern geplant und organisiert werden. Diese Feste stehen unter einem bestimmten Motto, das vielseitig und kreativ umgesetzt wird. Dabei sind rund um die Kita viele Spiele für Groß und Klein, eine Cafeteria, Stockbrot und Grillwurst und hin und wieder auch eine Tombola zu Gunsten der Kita zu finden.
Herbstfest
Zum Abschluss einer spannenden Herbst-Projektwoche gestalten wir traditionell in unserer Kita in Alveslohe zusammen mit den Kindern, Eltern und Großeltern einen bunten Herbstnachmittag.
Unsere Gäste sind eingeladen, die mit den Kindern hergestellten Apfelkuchen, Kürbisbrote sowie Marmeladen auszuprobieren. Gemeinsam wird mit den Herbstfrüchten, die vorher in einem Wahrnehmungsparcours ertastet worden sind, gebastelt. Bei Stockbrot und Feuerschein singen zum Abschluss alle gemeinsam an der Feuerstelle.
St. Martins-Fest
Zu unserem traditionellen St. Martins-Fest im November finden sich Groß und Klein auf dem Kitagelände mit den selbst gebastelten Laternen ein, um bei einer Theateraufführung der Geschichte vom Soldaten Martin zu lauschen, der vor vielen Jahrhunderten seinen Mantel mit einem armen Bettler teilte. Anschaulich vermitteln die Bilder Anteilnahme und Fürsorge. Im Anschluss wandern die Familien mit ihren leuchtenden Laternen durch die Straßen und singen dabei die schönen Laternenlieder. Zum Abschluss stärken sich Kinder, Eltern, Großeltern mit Punsch, heißem Kakao und den unverzichtbaren leckeren Stutenkerlen.
Unser vorweihnachtliches Fest
Ab Ende November steigt die Vorfreude auf das schönste Fest des Jahres, das Weihnachtsfest. Nicht laut, nicht hektisch, sondern stimmungsvoll wird der Zeitraum vor dem Fest bewusst gestaltet. Während der Adventszeit beginnt jeder Morgen besinnlich mit einer Geschichte aus dem Adventskalender. In der Weihnachtswerkstatt wird gewerkelt, Kekse werden gebacken, Weihnachtslieder tönen durchs Haus und auch das große Knusperhaus wird nach und nach fertiggestellt. Gemeinsam hören wir die Erzählungen über den Nikolaus und die Weihnachtsgeschichte. Zur gemütlichen Adventsknusperstunde im Familienzentrum sind alle Familien herzlich eingeladen.
Übernachtung- und Verabschiedung der Lernwerkstattkinder
Besondere Erlebnisse sind für unsere zukünftigen Schulkinder die Übernachtung im Kindergarten und der Tag ihrer offiziellen Verabschiedung aus dem Kindergarten. Am Übernachtungsabend kommen sie mit Schlafsack, Isomatte und Kuscheltier ausgestattet in die Kita. Vor dem Einschlafen wird zunächst einmal gemeinsam gegessen, um sich für die aufregende Nacht zu stärken. Nach vorheriger Planung mit den Kindern gibt es ein kleines Lagerfeuer oder eine Nachtwanderung, vielleicht ein kurzes Theaterspiel oder eine Schnitzeljagd im Garten.
Vor Beginn der Schul-Sommerferien laden wir alle Eltern der zukünftigen Schulkinder zu einer Abschiedsfeier ein, bei der wir gemeinsam noch einmal (durchaus etwas wehmütig…) auf die Kindergartenzeit zurückschauen. Im Anschluss wird jedes „Schulkind“ persönlich mit einem Abschiedsgeschenk geehrt und verlässt die Kita mit großer Vorfreude auf die Schulzeit.
In Alveslohe dürfen beim traditionellen „Fenstersprung“ alle „Großen“ aus dem Fenster in Richtung Schule springen. Eine spannende Kindergartenzeit ist nun endgültig zu Ende.
Der Abschluss der Kita-Zeit
Das letzte Kindergartenjahr
Mit dem letzten Kindergarten-Jahr beginnt der Übergang vom Kindergarten in die nächste Bildungsinstitution, die Grundschule. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Kinder sensibel und motivierend bei ihrer Vorfreude, den Ängsten, Sorgen und Unsicherheiten, die mit der anstehenden Veränderung – dem Übergang in die Schule – verbunden sind, zu begleiten. Hierfür bieten sich viele Gelegenheiten im Kita-Alltag.
Mit gemeinsamen Gruppenzeiten und Lernwerkstattangeboten werden wir den besonderen und anspruchsvollen Themen der Kinder im letzten Jahr vor der Schule gerecht und unterstützen sie mit auf ihre besonderen Anforderungen zugeschnittenen Inhalten und Projekten.
In den Gruppenräumen finden die Kinder unterschiedlich herausfordernde Materialien zu Themen wie Mathematik, Sprache und Schrift, Kreativität, Experimente, Bauen und Konstruieren. Die Arbeitsmaterialien sind klar strukturiert und überwiegend selbsterklärend. Durch die Arbeit mit Lerntabletts, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, erlangen die Kinder die Fähigkeit, sich mit konkreten Arbeitsaufträgen auseinanderzusetzen und Lernaufgaben zu erfüllen. Es gibt unterschiedliche Anforderungsniveaus – von einfach bis schwierig -, die den individuellen Entwicklungsstand der Kinder berücksichtigen.
In dieser Zeit erfolgen der Besuch der Grundschulen und Horteinrichtungen, die Verkehrserziehung, Waldwochen, der Besuch einer Theatervorführung oder eines Museums.
Angebote zur sozial emotionalen Entwicklung, der eigenen Rollenidentifikation und zur Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder haben ebenfalls einen festen Platz in unserer pädagogischen Arbeit. In diesem Alter ist die Identifikation mit dem eigenen „Ich“ und das eigene Geschlechterbewusstsein ein wichtiges Entwicklungsthema. Wir unterstützen die Kinder dabei, sich selbst als Junge* oder Mädchen* zu sehen, sich zu spüren und Unterschiede zu anderen Kindern zu entdecken.
Die Aktionstage und Angebote orientieren sich grundsätzlich an den Interessen und Themen der angehenden Schulkinder und ermöglichen ihnen eine schrittweise Auseinandersetzung mit den bevorstehenden Veränderungen. Die Kinder verabschieden sich langsam von ihrer Rolle als Kindergartenkinder. In der Bestärkung dessen, was sie schon alles können und gelernt haben, entwickeln sie ein positives Selbstbild und nähern sich selbstbewusst und gestärkt ihrer neuen Rolle als Schulkinder.
Kurz vor dem Ende ihrer Kindergartenzeit proben die Lernwerkstattkinder der Kita ein Theaterstück ein. Bei der Auswahl der Geschichte entscheiden die Kinder gemeinsam, welches Stück sie aufführen möchten. Mit großer Aufregung werden dann die Rollen verteilt. Mit erstaunlich großer Ausdauer wird geprobt, die Kulissen gebastelt und Stück für Stück die Kostüme gefertigt. Dann ist er da, der Tag der Aufführung. Mit großem Stolz präsentieren die Kinder ihren Eltern und den jüngeren Kitakindern ihr Theaterstück und ernten viel Beifall.
Die Lernwerkstatt
Die Vorbereitung auf den neuen Lebensabschnitt „Schule“ ist kein von den anderen Aufgaben isolierter Part unserer Kita-Arbeit. Die Voraussetzungen für einen gelingenden Bildungsweg werden während der gesamten Kita-Zeit und nicht erst im letzten Jahr vor der Einschulung gelegt. Der Kindertagesstätte kommt dabei die Rolle einer ergänzenden Bildungseinrichtung zu. Die wichtigste Bildungsinstitution in der frühen Kindheit ist die Familie.
Die angehenden Schulkinder haben in den zurückliegenden Jahren viele grundlegende Lernerfahrungen in der Kita gemacht: sich in einer Gruppe zurechtfinden, Sozialkontakte knüpfen, neue Bezugspersonen kennenlernen, Strukturen, Regeln und Rituale erfahren, um nur einige Beispiele zu nennen. Ihre Themen werden mit zunehmendem Alter deutlich individueller und differenzierter.
Um ihrer Neugierde und ihrem Wissensdurst auch im letzten Jahr gerecht zu werden, bieten wir den Kindern in den Projekten der Lernwerkstatt die fachlichen und organisatorischen Voraussetzungen, um elementare Kompetenzen differenzierter weiterzuentwickeln, wie z. B.
- Ausdauer und Konzentration
- Soziale Kompetenzen
- Auseinandersetzung mit demokratischen Erfahrungsräumen
- Erweiterung des Wortschatzes
- Unterstützung der Vorläuferfähigkeiten des Schriftspracherwerbs
- Mengen- und Zahlenerfassung
- Umweltbewusstsein
- Gewaltfreie Konfliktlösung
- Selbstbewusstsein und Ich-Stärke
Dabei greifen wir die Themen der Kinder auf, die sie beschäftigen und interessieren. Darauf aufbauend werden die Inhalte der Projektarbeiten gemeinsam mit den Kindern besprochen. Themen wie „Dinosaurier“, „ich, du und wir“, oder „Kinder und Kunst“ entwickeln sich im spannenden gemeinsamen Prozess. Der Ausflug in die Kunsthalle Hamburg wird so zum großen Erlebnis rund um das Thema „Farbe“ und öffnet unseren Kindern einen Blick in eine neue Welt.
Zusammenarbeit mit der Schule
Die Zusammenarbeit mit den Grundschulen ist unverzichtbarer Bestandteil des pädagogischen Konzeptes der Tausendfüßler Kindertagesstätten.
Ein Kooperationsvertrag zwischen den ortsansässigen Grundschulen und den Kindertagesstätten definiert die Ziele und Wege der Zusammenarbeit.
Beide Institutionen haben das Ziel, die Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie ihre Lernbereitschaft und Lernkompetenz zu fördern. Dazu ist es erforderlich, in einen gemeinsamen Fachaustausch zwischen Kita und Schule zu treten.
Das Bestreben der Tausendfüßler Stiftung als Träger ihrer Kindertagesstätten ist es, die Zusammenarbeit zu intensivieren, um für alle Kinder optimale Voraussetzungen für den Einstieg in die Grundschule zu ermöglichen.
Um die Schulfähigkeit der Kinder aus verschiedenen Blickwinkeln zu ermessen, erstellen die Kita-Fachkräfte von jedem zukünftigen Schulkind einen Einschätzungsbogen. Die Eltern erhalten selbstverständlich Einblick in diese Unterlagen, verbunden mit einem ausführlichen Gespräch über den Entwicklungsstand ihres Kindes. Mit der vorliegenden Einverständniserklärung der Eltern wird dieser Bogen an die Schule weitergegeben. Die Schulen erhalten so schnell einen Überblick über den Entwicklungsstand des einzuschulenden Kindes und die darin enthaltenen Informationen finden bei der Einschulungsuntersuchung Berücksichtigung.
Treten Fragen oder Bedenken zur Schulfähigkeit z. B. eines „Kann-Kindes“ auf, so suchen beide Institutionen das Gespräch, um gemeinsam mit den Eltern eine für das Kind richtige Entscheidung zu treffen oder ggf. noch individuelle entwicklungsfördernde Maßnahmen zu erwägen.
Die Grundschulen laden die Eltern im Herbst eines Jahres zu Informationsveranstaltungen ein, um ihre individuellen Konzepte vorzustellen. Im Frühjahr besuchen die angehenden Schulkinder die ortsansässigen Schulen, um z. B. an einer Unterrichtsstunde teilzunehmen und die spannenden Örtlichkeiten kennenzulernen. Vor den Sommerferien werden alle Kinder von „ihrer“ Grundschule zu einer Schnupperstunde von der zukünftigen Klassenlehrkraft eingeladen.
So wird Schule Stück für Stück vertrauter und Ängste und Unsicherheiten können einer gespannten Vorfreude weichen.
Anlage A - Beteiligungsverfahren
„Partizipation von Kindern in Kindertageseinrichtungen ist der Schlüssel zu Bildung und Demokratie und beginnt in den Köpfen der Erwachsenen…“ (Rüdiger Hansen)
Unsere Prämisse: Gelingende Beteiligung ist präventiver Kinderschutz
Was verstehen wir unter der Beteiligung von Kindern in unseren Einrichtungen?
Beteiligung bedeutet für uns Fachkräfte…
- Wir sind in der Gestaltung unseres „Lebensraumes Kita“ demokratischen Werten und Rechten verpflichtet. Das gilt für alle – Kinder, Eltern, Mitarbeiter:innen und Träger.
- Wir beteiligen Kinder altersgerecht an den sie betreffenden Themen und Entscheidungen, soweit möglich und mit unserer Verantwortung für das Wohl der Kinder.
- Wir informieren Kinder in verständlicher Sprache und altersgerecht über ihre Rechte und Möglichkeiten von Mitbestimmung.
- Wir sind überzeugt, dass Kinder durch Beteiligung lernen, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen.
- Wir ermuntern Kinder, sich zu beteiligen und eine eigene Meinung zu bilden. Wir vermeiden es, wenn möglich, eigene Entscheidungen/Lösungen vorwegzugreifen.
- Beteiligung verstehen wir dabei nicht ausschließlich als demokratisches Abstimmungsverfahren, sondern als Dialog und gemeinsame Entscheidungsfindung der Kinder untereinander und mit den Pädagog:innen.
- Wir nehmen dabei die Meinungen, Bedürfnisse und auch die Kritik der Kinder ernst und begründen ihnen gegenüber unsere Entscheidungen.
So funktioniert Beteiligung…
„Beteiligung in der Kita“ meint die altersgerechte Beteiligung von Kindern bei sie betreffenden Themen und Entscheidungen. Die Beteiligungsformen orientieren sich also an den Kompetenzen der Kinder und variieren je nach Altersgruppe.
Beteiligung braucht Geborgenheit…
Kinder brauchen das Gefühl, angenommen zu sein und mit ihrer Meinung ernstgenommen zu werden. Ermutigung zur Beteiligung kann nur gelingen, wenn die Atmosphäre eine annehmende ist und Sicherheit bietet. Dann spüren Kinder, dass ihre Beteiligung tatsächlich etwas bewirken und verändern kann.
Beteiligung braucht Vorbilder…
Kinder greifen auf, was ihnen vorgelebt wird. Deshalb braucht Beteiligung auch Vorbilder: Erwachsene, die neugierig sind, Dinge auch mal in Frage stellen und gemeinsam mit anderen nach Antworten und Lösungen suchen.
Beteiligung braucht Transparenz…
Alle beteiligten Personen müssen wissen, welche Rechte sie haben, und wo Mitbestimmung möglich ist. Wer seine Rechte nicht kennt, kann sie auch nicht einfordern!
Beteiligung ist freiwillig…
Wer sich nicht einbringen möchte, kann auch nicht dazu gezwungen werden. Beteiligung ist immer als freiwilliges Angebot zu verstehen.
Beteiligung muss einfach sein…
Beteiligung kann auch an Überforderung scheitern, etwa wenn die Regeln zu kompliziert oder die Hürden zu hoch sind. Daher müssen Mitmach-Regeln einfach und nachvollziehbar sein und sich nach den Möglichkeiten und Grenzen der zu Beteiligenden richten. Oft sind dabei Unterstützung und Begleitung erforderlich.
Beteiligung muss gewollt sein…
Generell gilt für Beteiligung, ob nun für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene: Eine Alibi-Beteiligung, die nicht wirklich gewollt ist, frustriert und wird schnell durchschaut. Die „Beteiligten“ verlieren die Lust am Mitmachen. Das Gleiche gilt auch, wenn Mitbestimmung nichts verändern kann und wirkungslos bleibt.
Wie wird die Beteiligung der Kinder in unseren Kindertagesstätten sichergestellt?
- Durch Schaffung einer vertrauensvollen Atmosphäre und durch den Aufbau verlässlicher Beziehungen zu jedem einzelnen Kind
- Die Pädagog:innen beobachten die Entwicklungsschritte der Kinder und können so auf die wahrgenommenen Gefühlsäußerungen reagieren.
- Jedes Kind wird darin bestärkt, dass es das, was es selbst tun kann, auch selbst tut.
- Abstimmungen finden in der Kindergruppe mit Muggel-Steinen, per Hand, offen oder geheim zu relevanten Themen im Kita-Alltag statt.
- In der Themenfindung für Feste oder Projekte machen die Kinder Vorschläge und stimmen darüber ab.
- Bei Ausflügen in die Umgebung bestimmen die Kinder das Ziel.
- Im Morgenkreis wählen die Kinder aus einem vorgegebenen Angebot Spiele/ Lieder Aktionen für die Gruppe aus.
- In den Gruppenzeiten diskutieren und beschließen die Kinder gemeinschaftlich die Planung der Aktivitäten.
- In der offenen Spielzeit darf jedes Kind entscheiden was, wo, wie lange und mit wem es spielt, an welchem Angebot es teilnimmt.
- Über die Teilnahme an Projekten oder pädagogischen Angeboten entscheiden die Kinder nach ihren Bedürfnissen und Bildungsthemen.
- Die Kinder entscheiden wie lange sie bei einer Tätigkeit (Mahlzeit, Angebote, Spiel auf dem Außengelände…) bleiben.
- Frühstück/ Snack: Jedes Kind entscheidet innerhalb festgelegter Rahmen-bedingungen wann es essen geht, was und wieviel es essen möchte.
- Tischsprüche werden durch Fotos oder Symbole dargestellt und können selbständig von den Kindern ausgewählt werden.
- Kinder werden in die Körperhygiene einbezogen, bestimmen selbst, wann eine frische Windel notwendig ist, wer sie wickeln darf, wer beim Umziehen oder beim Toilettengang helfen darf.
Die pädagogischen Fachkräfte sind stets gefordert, sich mit folgenden Fragestellungen auseinander zu setzen:
- Wie können wir die Kinder beteiligen?
- Wie können wir ihnen ihre Rechte verständlich machen?
- Wie kann die Umsetzung erfolgen
Unser Beteiligungsverfahren ist angelehnt an: „Kinderrechte stärken“ Der Paritätische Nordrhein-Westfalen
Anlage B - Beschwerdemanagement
Unser Grundsatz: Beschweren erwünscht!
Beschwerden in unseren Kindertageseinrichtungen können von Eltern, Kindern und Mitarbeiter*innen in Form von Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder Anfragen ausgedrückt werden.
Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die sich abhängig vom Alter, Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener Weise über eine verbale Äußerung als auch über Weinen, Wut, Traurigkeit, Aggressivität oder Zurückgezogenheit ausdrücken kann.
Können sich die älteren Kindergartenkinder und Schulkinder schon gut über Sprache mitteilen, muss die Beschwerde der Allerkleinsten von dem Pädagog:innen sensibel aus dem Verhalten des Kindes wahrgenommen werden. Achtsamkeit und eine dialogische Haltung der pädagogischen Fachkraft sind unbedingte Voraussetzungen für eine sensible Wahrnehmung der Bedürfnisse des Kindes.
Aufgabe des Umgangs mit jeder Beschwerde ist es, die Belange ernst zu nehmen, den Beschwerden nachzugehen, diese möglichst abzustellen und Lösungen zu finden, die alle mittragen können.
Wir verstehen Beschwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung unserer Arbeit in unseren Einrichtungen. Darüber hinaus bieten sie ein Lernfeld und eine Chance, das Recht der Kinder auf Beteiligung umzusetzen. Dies erfordert partizipatorische Rahmenbedingungen und eine Grundhaltung, die Beschwerden nicht als lästige Störung, sondern als Entwicklungschance begreift.
Ziel unseres Beschwerdemanagements ist es, Zufriedenheit (wieder) herzustellen.
Unsere Beschwerdekultur als Mitarbeitende
- Wir tragen die Verantwortung als Vorbilder
- Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um
- Wir führen eine offene Kommunikation miteinander
- Wir dürfen Fehler machen
- Wir zeigen eine reklamationsfreundliche Haltung
- Wir gehen sorgsam und respektvoll mit Beschwerden um
- Wir nehmen Beschwerden sachlich an und nicht persönlich
- Wir suchen gemeinsam nach verbindlichen Lösungen
Unser Beschwerdeverfahren für die Kinder
Wir regen die Kinder an, Beschwerden zu äußern
- durch Schaffung eines sicheren Rahmens (eine verlässliche und auf Vertrauen aufgebaute Beziehung), indem Beschwerden angstfrei geäußert werden können und mit Respekt und Wertschätzung angenommen und bearbeitet werden
- indem sie im Kita-Alltag erleben, dass sie bei Unzufriedenheit auch über Ausdrucksformen wie Weinen, Zurückziehen und Aggressivität ernst- und wahrgenommen werden
- indem Kinder ermutigt werden, eigene und Bedürfnisse anderer zu erkennen und sich für das Wohlergehen der Gemeinschaft einzusetzen
- indem Pädagog:innen positive Vorbilder im Umgang mit Beschwerden sind und auch eigenes (Fehl-)Verhalten, eigene Bedürfnisse reflektieren und mit den Kindern thematisieren
In unseren Kitas können die Kinder sich beschweren
- wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen
- in Konfliktsituationen
- über unangemessene Verhaltensweisen der Pädagog*innen
- über alle Belange, die ihren Alltag betreffen (Angebote, Essen, Regeln, etc.)
Die Kinder bringen ihre Beschwerden zum Ausdruck
- durch konkrete Missfallensäußerungen
- durch Gefühle, Mimik, Gestik und Laute
- durch ihr Verhalten wie z. B. Verweigerung, Anpassung, Vermeidung,
Regelverletzungen, Grenzüberschreitungen
Die Kinder können sich beschweren bei den Mitarbeiter:innen in der Einrichtung, bei ihren Freunden, bei den Eltern, …
Die Beschwerden der Kinder werden aufgenommen und dokumentiert
- durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung
- durch den direkten Dialog der Pädagog:innen mit dem Kind/den Kindern
- durch die Visualisierung der Beschwerden oder eine Befragung durch die Kinder
- im Rahmen von Befragungen durch die Pädagogen
Die Beschwerden der Kinder werden bearbeitet
- mit dem Kind/den Kindern auf Augenhöhe, um gemeinsam Antworten bzw. Lösungen zu finden
- im Dialog innerhalb einzelner Kindergruppen zu einem bestimmten Thema
- in Teamgesprächen, bei Dienstbesprechungen
- in Elterngesprächen/auf Elternnachmittagen/bei Elternbeiratssitzungen
- in Teamleitungsrunden mit der Fachbereichsleitung
- mit dem Träger
Unser Beschwerdeverfahren für die Eltern
Die Eltern werden informiert über das Beschwerdeverfahren
- beim Aufnahmegespräch und beim Erstgespräch mit den zuständigen Pädagog:innen
- bei Elternnachmittagen
- durch Hinweise an der Infotafel in der Einrichtung
- bei Elternbefragungen
- im täglichen Dialog mit den pädagogischen Fachkräften
- über die Elternvertreter:innen
- über die Fachbereichsleitung und Träger
Die Eltern können sich beschweren
- bei den Fachkräften in der Gruppe und bei der Teamleitung
- bei der Fachbereichsleitung der Tausendfüßler Kindertagesstätten
- beim Träger
- bei den Elternvertreter:innen als Bindeglied zur Kita
- auf den Beiratssitzungen
- bei Elternnachmittagen in der Einrichtung
- schriftlich über das Beschwerdeformular
- über die anonymisierte Elternbefragung
Die Beschwerden der Eltern werden aufgenommen und dokumentiert
- durch Wahrnehmung und Beobachtung
- im direkten Dialog, per Telefon oder E-Mail
- über das Beschwerdeformular
- bei Tür- und Angelgesprächen
- bei vereinbarten Elterngesprächen
- von den pädagogischen Fachkräften, der Fachbereichsleitung, dem Träger
- im Beschwerdeprotokoll
- durch Einbindung der Elternvertreter:innen
- mittels der anonymisierten Elternbefragung
Die Beschwerden werden bearbeitet
- entsprechend dem Beschwerdeablaufplan
- im Dialog auf Augenhöhe, um gemeinsam Lösungen zu finden
- in Elterngesprächen
- auf Elternnachmittagen
- im Dialog mit Elternvertreter:innen
- in Teamgesprächen sowie in Teamleitungsrunden
- durch Weiterleitung an die zuständige Stelle
- von der Fachbereichsleitung
- vom Träger
Wer ist Ansprechpartner für Beschwerden in persönlichen Angelegenheiten?
Für Kinder sind die pädagogischen Fachkräfte oder die Teamleitung Ansprechpartner, wenn sie ihre Beschwerden nicht untereinander klären können. Für Eltern sind die pädagogischen Fachkräfte, die Teamleitung, der Träger oder auch die Elternvertreter:innen ihre Ansprechpartner:innen.
Wie werden den Kindern/ den Eltern die Beschwerdemöglichkeiten bekannt gemacht?
Kinder erfahren über eine adäquate Gesprächskultur in der Einrichtung ihre Möglichkeiten. Pädagog:innen nehmen die Befindlichkeiten der Kinder sensibel wahr und verbalisieren, fragen, machen ein Angebot, greifen ein, unterstützen, handeln als Vorbilder z. B. bei Auseinandersetzungen. Sie suchen das Gespräch im Einzelfall und nutzen bewusste Visualisierung und eine konkrete Thematisierung innerhalb einer Gesprächsgruppe.
Eltern erhalten Informationen zu ihren Beschwerdemöglichkeiten beim Erstgespräch, über Aushänge und Informationsmaterialien. Ihre mögliche Unzufriedenheit wird von den Mitarbeiter:innen der Kita möglichst frühzeitig wahrgenommen, angesprochen (wenn sie es nicht von selbst tun), ihre Beschwerde wird ernstgenommen und transparent bearbeitet.
Wie wird die Qualität der Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren in der Einrichtung geprüft und weiterentwickelt?
Die Kinder werden im Beschwerdefall gefragt, ob die Situation zufriedenstellend geklärt wurde. Verbindliche Absprachen werden visualisiert z. B. über Plakate an der Infotafel. Beidseitig findet eine Kontrolle der Einhaltung von Absprachen und Regeln statt. Neu aufgenommene Kinder werden in das bestehende Beschwerde-System eingeführt.
Die Thematik wird regelmäßig bei Dienstbesprechungen, im Fachaustausch der Team-leitungsrunde mit dem Träger und bei Teamfortbildungen bearbeitet. Aus den Rückmeldungen erfolgt bei Bedarf eine konzeptionelle Anpassung.
Für die Überprüfung und Weiterentwicklung des Beschwerdeverfahrens nutzen die Fachkräfte die Tür- und Angelgespräche mit den Eltern, um z. B. zu erfahren, ob Situationen zufriedenstellend geklärt wurden. Eingegangene Beschwerden sowie die Ergebnisse der anonymisierten Elternbefragungen werden ausgewertet. Entsprechende Elterngespräche werden in Dienstbesprechungen erörtert. Rückschlüsse, die auf eine Überarbeitung des Beschwerdeverfahrens hinweisen, werden im Fachaustausch der Teamleitungsrunde mit dem Träger bearbeitet und führen ggf. zu einer konzeptionellen Anpassung.
Entscheidend bleibt der Anspruch der Tausendfüßler Stiftung, die Arbeitsfelder kontinuierlich durch Lernprozesse zu optimieren. Alle Arbeitsabläufe müssen daher laufend im Dialog mit Kindern und Eltern reflektiert werden. Das erfordert eine offene Kommunikation mit allen und für alle: Kindern, Eltern, Familien, Pädagog:innen, Führungskräften und dem Träger.
HIER kommen Sie zu unserem Beschwerdeformular.
Anlage C - Gesetzliche Grundlagen Kinderschutz
§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass
- deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,
- bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie
- die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
Seite 66 von 67
§ 8b SGB VIII Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien
- zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie
- zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten.
§ 47 SGB VIII Meldepflichten
Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde unverzüglich
- die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und Anschrift des Trägers, Art und Standort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie der Namen und der beruflichen Ausbildung des Leiters und der Betreuungskräfte,
- Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen, sowie
- die bevorstehende Schließung der Einrichtung
anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie der Konzeption sind der zuständigen Behörde unverzüglich, die Zahl der belegten Plätze ist jährlich einmal zu melden.
§ 72a SGB VIII Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen.
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat.
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen über die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.
(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 eingesehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Information erheben, ob die das Führungszeugnis betreffende Person wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese erhobenen Daten nur speichern, verändern und nutzen, soweit dies zum Ausschluss der Personen von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spätestens drei Monate nach der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen.
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.
(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.